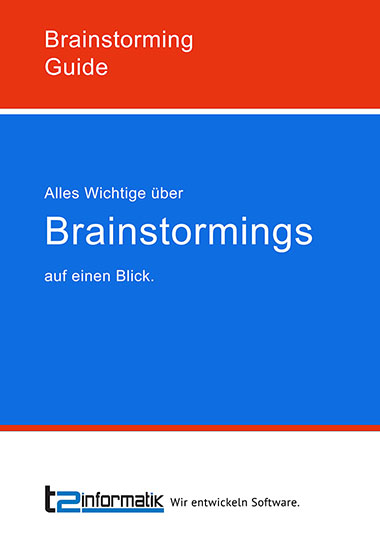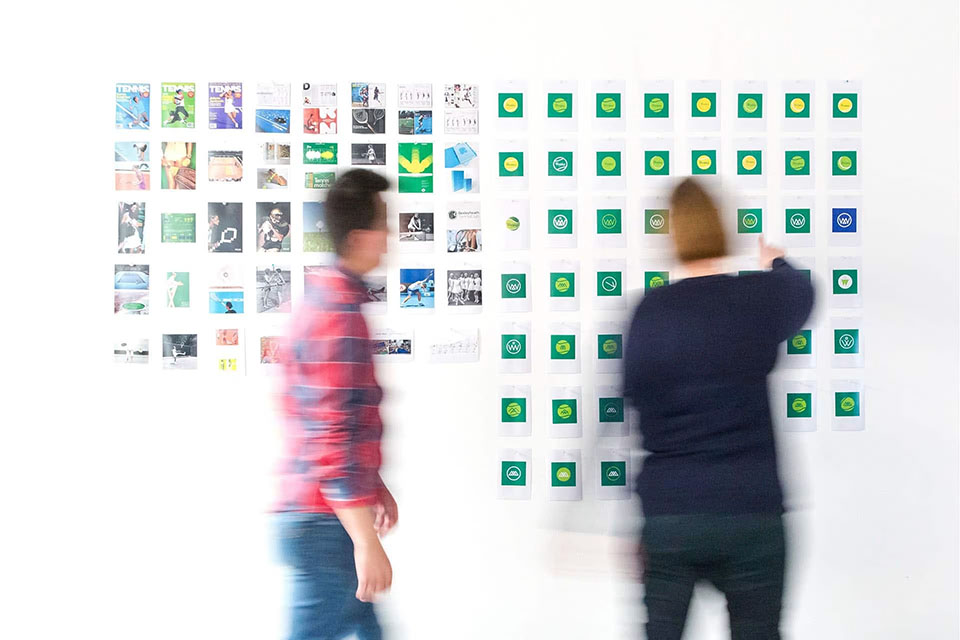Brainstorming
Inhaltsverzeichnis: Definition – Ablauf – Regeln – Tipps – Vorteile und Nachteile – Fragen aus der Praxis – Download – Hinweise
Wissen kompakt: Brainstorming ist eine Kreativitätstechnik, bei der eine Gruppe von Personen gemeinsam versucht, eine Aufgabe durch die Sammlung und Weiterentwicklung von Ideen zu lösen.
Brainstorming – die gemeinsame Entwicklung von Ideen im Team
Der Erfinder von Brainstorming Alex Faickney Osborn umschrieb seine Kreativitätstechnik mit „Using the brain to storm a problem“. Es ist ein Format für eine Gruppe, die versucht, eine Aufgabe oder ein Problem zu lösen, indem sie gemeinsam Ideen generiert und diese anschließend bewertet.
Osborn orientierte sich bei der Entwicklung von Brainstorming 1939 an der indischen Prai-Barshana-Technik, die es seit ca. 400 Jahren gibt. Später wurde Brainstorming von Charles Hutchison Clark als Methode zur Ideenfindung im Team weiterentwickelt. Heute gilt Brainstorming als Klassiker der Kreativitätstechniken, der in der Produkt- und Dienstleistungsentwicklung, in allen denkbaren Organisationsbereichen und Organisationen oder bei der Lösung von Problemen genutzt wird.
Brainstorming Ablauf
Brainstorming folgt einem klaren Ablauf aus
- Vorbereitung,
- Durchführung mit Ideenfindung und Ideenbewertung sowie
- Nachbereitung.
Im Zuge der Vorbereitung des Brainstormings wird das Team anhand der Problemstellung zusammengestellt, also bspw. Mitarbeiter eines Fachbereichs, Experten eines Themengebiets oder auch fachfremde „externe“ Kollegen.
Zu Beginn der Durchführung sollten die Brainstorming-Regeln, der konkrete Ablauf und auch die Timebox (bspw. 30 oder 45 Minuten) genannt werden. Darüber hinaus empfiehlt es sich, einen Protokollanten – in der Praxis häufig auch identisch mit dem Moderator – zu benennen.
Es folgt die Darstellung des Problems durch den Moderator. Die Problemstellung sollte an einer Tafel, einem Flipchart oder einem Whiteboard jederzeit sichtbar festgehalten werden, so dass die Teilnehmer im Laufe des Brainstormings leichter den benötigten Fokus halten können.
Nun dürfen die Teilnehmer spontan ihre Ideen zur Problembeseitigung bzw. Lösungsfindung nennen. Idealerweise inspirieren sich die Teilnehmer gegenseitig, so dass aus einzelnen Ideen auch andere Ideen abgeleitet werden können. Sämtliche Ideen gilt es unmittelbar zu dokumentieren. Dabei ist unbedingt darauf zu achten, dass die Informationen vom Protokollanten / Moderator nicht „übersetzt“ oder „gekürzt“ werden. Sie sollten so ursprünglich wie von den Teilnehmern formuliert dokumentiert und nicht „verfremdet“ werden.
Nach der Ideenfindung folgt die gemeinsame Ideenbewertung. Dafür werden die Ideen gruppiert, analysiert, gefiltert und bewertet. Das Ziel beim Brainstorming ist es, eine Liste mit den besten Ideen oder Lösungsvorschlägen zu erstellen, um idealerweise die vielversprechende(n) davon zu realisieren. Auch die Ideenbewertung sollte mit einer Timebox (bspw. 30 oder 60 Minuten) versehen werden.
Zum Abschluss gilt es das weitere Vorgehen zu beschreiben: wer tut was bis wann, wie sehen mögliche nächste Schritte aus, wann treffen sich die Teilnehmer ggf. zu einer zweiten Runde etc.
Im Zuge der Nachbereitung werden die Ergebnisse aufbereitet den Teilnehmern zur Verfügung gestellt. Es empfiehlt sich grundsätzlich auch, neue Informationen, Erkenntnisse und Entwicklungen regelmäßig zu kommunizieren.
Brainstorming Regeln
Damit Brainstorming funktioniert, sind einige einfach klingende Regeln zu beachten:
- Die Kritik an Ideen und Gedanken ist jedem Teilnehmer (und damit auch dem Moderator oder dem Protokollanten) strikt untersagt. Auch generelle Kritik an einzelnen Ideengebern ist nicht erlaubt; Ziel ist eine wertschätzende, offene und faire Kommunikation zur Lösung eines Problems bzw. einer Aufgabenstellung.
- Jegliche Idee – so unwahrscheinlich sie auch klingen mag – ist eine gute Idee.
- Geäußerte Ideen dürfen von allen Teilnehmern weiterentwickelt werden. Es gibt somit kein Copyright auf Ideen.
- Klare Zeitvorgaben als Timebox (bspw. 45 Minuten für die Ideenfindung und 30 Minuten für die Ideenbewertung) sowie die Ziele einzelner Sessions müssen kommuniziert werden.
- Jeder Teilnehmer kann, muss sich aber nicht einbringen.
Um sicherzustellen, dass das Brainstorming effektiv ist, sollten diese Regeln befolgt werden. Eine wertschätzende und offene Kommunikation ist der Schlüssel zum Erfolg. Durch das Teilen und Weiterentwickeln von Ideen können innovative Lösungen gefunden werden.
Tipps zur Durchführung von Brainstormings
Es gibt eine Reihe von Tipps, die sich in der Praxis als nützlich erwiesen haben:
- Den Teilnehmenden sollten sowohl der Ablauf, die Regeln, die Fragestellung und die Zielsetzung sowie die Timebox klar sein.
- Es kommt vor, dass die Fragestellung zu umfangreich ist. Hier empfiehlt es sich – auch im Laufe einer Session – Teilfragen zu extrahieren und diese einzeln zu thematisieren. Lassen sich weder alle Teilfragen noch die allgemeine Ausgangsfrage innerhalb einer Session beantworten, sollte ein neuer Termin für einen neuen Austausch vereinbart werden.
- Zur Einhaltung der Timebox sollte es einen Timekeeper geben, der auch bei einem regen Austausch untereinander auf die vereinbarte Zeit achtet.
- Das Klima bei der Sammlung und anschließenden Bewertung von Ideen ist wichtig für die Quantität und Qualität der Beiträge. Natürlich kann der Moderator versuchen moderierend einzuwirken, jedoch obliegt es allen Teilnehmenden sich an die Regeln zu halten und bei Bedarf auch andere freundlich an die Einhaltung dieser zu erinnern.
- Interdisziplinäre Brainstormings erhöhen einerseits das Verständnis zwischen Rollen, Mitarbeitenden und Bereichen und bieten anderseits andere Blickwinkeln und Perspektiven auf die Fragestellung.
- Die Visualisierung der Beiträge an einem Whiteboard oder einer Pinnwand erleichtert den Austausch und fördert die Weiterentwicklung von Ideen.
- Die Aufbereitung der Ergebnisse und das Ableiten von Maßnahmen runden den Austausch ab. Auch hier sind der Moderator und/oder der Timekeeper gefragt, genügend Zeit für diesen Teil des Treffens vorzusehen.
- In manchen Situationen kann es sinnvoll sein, kleinere Anpassungen am Vorgehen vorzunehmen. Bspw. gibt es beim „Round Robin“ eine Art „Rundlauf“, bei dem die Person, die als erstes eine Idee äußert, anschließend bestimmt, ob diejenige Person, die links oder rechts von ihr sitzt, die nächste Idee äußern soll; so wird sichergestellt, dass alle Teilnehmenden zu Wort kommen. Und bei der „Silent Reflection bzw. „Stillen Reflexion“ erhalten die Teilnehmenden die Möglichkeit, zuerst in Ruhe und für sich selbst Ideen zu notieren, bevor sie verbal kommuniziert werden.
Und zu guter Letzt: Brainstormings dürfen Spaß machen, sind aber kein Spaß. Es geht häufig um die Lösung von Problemen, die Weiterentwicklung von Produkten oder Services. Die Ideen dazu sind Mittel zum Zweck. Es empfiehlt sich also auch immer darauf zu achten, dass Ideen auch umgesetzt und die Umsetzung im Teilnehmerkreis zu einem späteren Zeitpunkt diskutiert und ggf. auch bewertet werden. Entsprechende Erkenntnisse lassen sich bspw. in Lessons Learned festhalten.
Brainstorming Vorteile und Nachteile
Brainstorming bietet eine Reihe von Vorteilen:
- Die Regeln sind leicht zu verstehen.
- Der Ablauf ist mit Übung, einem erfahrenen Moderator, einem gemeinsamen Ziel und gegenseitige Rücksichtnahme gut umzusetzen.
- Der Aufwand für die Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung hält sich in Grenzen.
- Das assoziative und nicht bewertende Sammeln von Ideen fördert neue und ggf. auch unkonventionelle Lösungsansätze.
- Das Entwickeln divergierender, vielfältiger Ideen macht Spaß, fördert die Kreativität und stärkt das Miteinander.
- Nehmen Vertreter verschiedener Bereiche oder Disziplinen am Austausch teil, besteht zudem die Möglichkeit, voneinander zu lernen.
Es gibt jedoch auch eine Reihe von Herausforderungen bzw. Nachteilen:
- Introvertierte Mitarbeiter tun sich häufig schwer, Gedanken und Ideen in der „Öffentlichkeit“ zu äußern.
- „Vielredner“ oder „Lautsprecher“ negieren schnell den gemeinsamen Zweck des Brainstormings.
- Vorgesetzte kommunizieren oftmals auch nonverbal, was sie von Ideen und Äußerungen einzelner Teilnehmer halten. Unter Umständen halten sich diese in der Folge zurück und wichtige Blickwinkel bleiben außen vor.
- Auch Teilnehmer beginnen häufig mit der Beurteilung von Meinungen und zerstören damit bewusst oder unbewusst das Format und einen Austausch auf Augenhöhe.
Die Einhaltung der Regeln klingt in der Theorie relativ einfach, in der Praxis ist die Umsetzung nicht immer einfach. Hier ist der Moderator häufig besondere gefordert. Ohne einen guten Moderator ist es schwierig, ein erfolgreiches Brainstorming zu gestalten. Greift er nicht moderierend ein, werden sich extrovertierte Mitarbeiter und/oder Vorgesetzte meist durchsetzen und viele Ideen eher introvertierter Mitarbeiter bleiben unausgesprochen. Das Ziel des Brainstormings wird verfehlt. Alternativ nutzen daher zahlreiche Organisationen verschiedene Varianten oder Alternativen.
Fragen aus der Praxis
Hier finden Sie einige Fragen und Antworten im Kontext von Brainstormings:
Welche Varianten oder Alternativen zum klassischen Brainstorming gibt es?
Varianten und Alternativen zum klassischen Brainstorming
Hier finden Sie eine Liste mit einigen Varianten und Alternativen, die zum Einsatz kommen, um andere Formen des Austauschs, ausgewählte Fragetechniken oder definierte Strukturen verwenden:
- Brainwriting ist eine nonverbale Kreativitätstechnik zur Ideenfindung, bei der die Teilnehmer ihre Ideen verschriftlichen. Die bekannteste Variante dürfte die 6-3-5 Methode sein.
- Braindumping beschreibt das Abladen von Gedanken und Ideen mithilfe von Morgenseiten und Aufgabenlisten. Das sogenannte Brain-Netting und auch Idea Napkin funktionieren ähnlich.
- Das Reverse Brainstorming ist ein Format, bei dem zu beantwortende Fragen negativ formuliert und konsolidierte Antworten ins Positive umgekehrt werden. Ähnliche Ansätze finden sich auch bei der Kopfstandtechnik oder dem Pre-Mortem.
- Das Round-Robin-Brainstorming ist ein Format, bei jedem sich alle Teilnehmenden in einer definierten Reihenfolge (ggf. in mehreren Runden) zu einem Thema äußern.
- 1-2-4-All ist ein Format, bei dem schrittweise die Anzahl der Teilnehmenden pro Runde erhöht werden. Es ist Teil der sogenannten Liberating Structures.
- SCAMPER ist eine Kreativitätsmethode, die mit einer Reihe von Schlüsselwörtern und Fragen die Suche nach Ideen erleichtert. Sie ist artverwandt mit der Osborn-Checkliste.
- Starbursting ist eine Kreativitätsmethode, die mittels Fragen Facetten eines Themas beleuchtet, bevor Antworten auf die Fragen gesucht werden. Ähnliche Ansätze finden sich auch in der 5-Why-Methode oder der 5W1H-Methode.
- Ein Pre-Mortem ist eine vorausschauende Rückschau, die Ursachen identifiziert, die zum Scheitern von Projekten beitragen werden.
- Die Kopfstandtechnik ist ein Brainstorming-Format, bei dem Fragen ins Negative und konsolidierte Antworten ins Positive umgekehrt werden.
Sicherlich lässt sich diese Liste mit weiteren Varianten und Alternativen verlängern.
Wie sinnvoll ist es, verschiedene Varianten oder Alternativen auszuprobieren?
Das Ausprobieren verschiedener Varianten oder Alternativen kann aus mehreren Gründen sehr sinnvoll sein:
- Jedes Format bringt eigene Stärken und Dynamiken mit sich, die unterschiedliche Arten der Ideenfindung und Gruppeninteraktion fördern können.
- Nicht jedes Team arbeitet auf die gleiche Weise effektiv. Verschiedene Varianten oder Alternativen können unterschiedlich gut zu verschiedenen Gruppencharakteristiken passen.
- Verschiedene Varianten und Alternativen können unterschiedliche Teilnehmer ansprechen und sie dazu ermutigen, sich einzubringen. Einige Personen fühlen sich vielleicht in offenen, freien Diskussionen wohler, während andere in strukturierten, regelbasierten Formaten besser arbeiten.
- Die Nutzung verschiedener Ansätze kann helfen, mögliche Routine zu durchbrechen und Teilnehmer zu motivieren. Dies ist besonders wichtig, um Kreativitätsblockaden zu vermeiden und das Engagement über die Zeit aufrechtzuerhalten.
Insgesamt kann das Experimentieren mit verschiedenen Varianten und Alternativen eine wertvolle Taktik sein, um die Effektivität von Brainstorming-Sitzungen zu maximieren, die Teamdynamik zu verbessern und innovative Lösungen für eine Vielzahl von Herausforderungen zu finden.
Welche Relevanz hat der Ansatz "Quantität ist wichtiger als Qualität" beim Brainstorming?
In zahlreichen Publikationen wird die Quantität von Ideen höher bewertet als deren Qualität. Der Gedanke dahinter: Indem man sich auf die Menge konzentriert, ermutigt man die Teilnehmer, frei und ohne Einschränkungen zu denken. Dies kann einerseits zu unerwarteten und innovativen Ideen führen, und andererseits andere Teilnehmer auf abgeleitete oder weiterentwickelte Ideen bringen, die große Erfolgsaussichten bieten.
Darüber hinaus ist der Ansatz „nur“ in Qualität zu denken, wenig praktikabel. Was ist eine qualitativ hochwertige, sinnvolle Idee?
Ein Nachteil des quantitativen Ansatzes liegt in der möglichen Menge an Ideen, die entsteht. Diese gilt es zu strukturieren und zu bewerten, was natürlich Aufwand erzeugt. Aus diesem Grund sollte auch das Vorgehen an sich strukturiert erfolgen. Letztendlich ist es wichtig, einen ausgewogenen Ansatz zu wählen, der sowohl die Generierung einer Vielzahl von Ideen als auch deren sorgfältige Bewertung und Verfeinerung ermöglicht.
Warum scheitern Brainstormings?
Brainstorming-Sitzungen können aus verschiedenen Gründen scheitern, und es ist wichtig, diese Hindernisse zu erkennen und zu adressieren, um effektivere Sitzungen zu gestalten. Hier finden Sie einige Gründe:
- Wenn die Ziele der Sitzung oder die Spielregeln für die Ideenfindung und -bewertung nicht klar definiert sind, können die Teilnehmer vom Thema abweichen oder unsicher sein, wie sie beitragen sollen.
- Oft übernehmen ein oder zwei laute Stimmen die Kontrolle über die Sitzung, was dazu führt, dass andere Teilnehmer sich zurückziehen und ihre Ideen nicht teilen.
- Wenn Teilnehmer sich nicht wohl fühlen, ihre Gedanken zu teilen, sei es aus Angst vor Kritik oder mangelndem Vertrauen in ihre eigenen Ideen, wird das Potenzial des Austauschs nicht voll ausgeschöpft.
- Eine der Grundregeln ist es, Kritik zu vermeiden, bis die Ideenfindungsphase abgeschlossen ist. Wenn Teilnehmer Ideen zu früh kritisieren, kann dies die Kreativität und Offenheit der Gruppe hemmen.
- Groupthink kann dazu führen, dass Teams nicht kritisch über Ideen nachdenken oder alternative Ansichten ignorieren.
- Ein Team, das in Bezug auf Erfahrung, Fachwissen, Perspektiven und Denkstile homogen ist, kann Schwierigkeiten haben, innovative oder kreative Lösungen zu generieren.
- Selbst wenn während des Austauschs gute Ideen generiert werden, kann das Fehlen eines effektiven Prozesses zur Bewertung, Auswahl und Umsetzung dieser Ideen dazu führen, dass nichts aus der Sitzung resultiert.
- Zu wenig Zeit für die Sitzung kann dazu führen, dass Ideen nicht vollständig entwickelt werden, während zu viel Zeit zu Abschweifungen und Produktivitätsverlust führen kann.
Um diese Fallstricke zu vermeiden, ist es wichtig, sich auf eine klare Struktur, offene Kommunikation, aktives Zuhören und die Einbeziehung aller Teilnehmer zu konzentrieren. Insbesondere der Moderator ist hier gefragt.
Impuls zum Diskutieren
In vielen Unternehmen funktionieren Brainstormings nicht wie gewünscht. Auch Tipps helfen nicht wirklich. Könnte es in solchen Situationen sinnvoll sein, ein Brainstorming über die Art und Weise der gemeinsamen Ideen- und Lösungsfindung durchzuführen?
Hinweise:
Wenn Ihnen der Beitrag gefällt, teilen Sie ihn gerne in Ihrem Netzwerk. Und falls Sie sich für Tipps aus der Praxis interessieren, dann testen Sie unseren wöchentlichen Newsletter mit neuen Beiträgen, Downloads, Empfehlungen und aktuellem Wissen. Vielleicht wird er auch Ihr Lieblings-Newsletter.
Hier finden Sie einen interessanten Beitrag von Jon Miller bei der Gemba Academy: When is “No Idea is a Bad Idea” a Bad Idea?
Und hier finden Sie ergänzende Informationen aus unserem Blog: