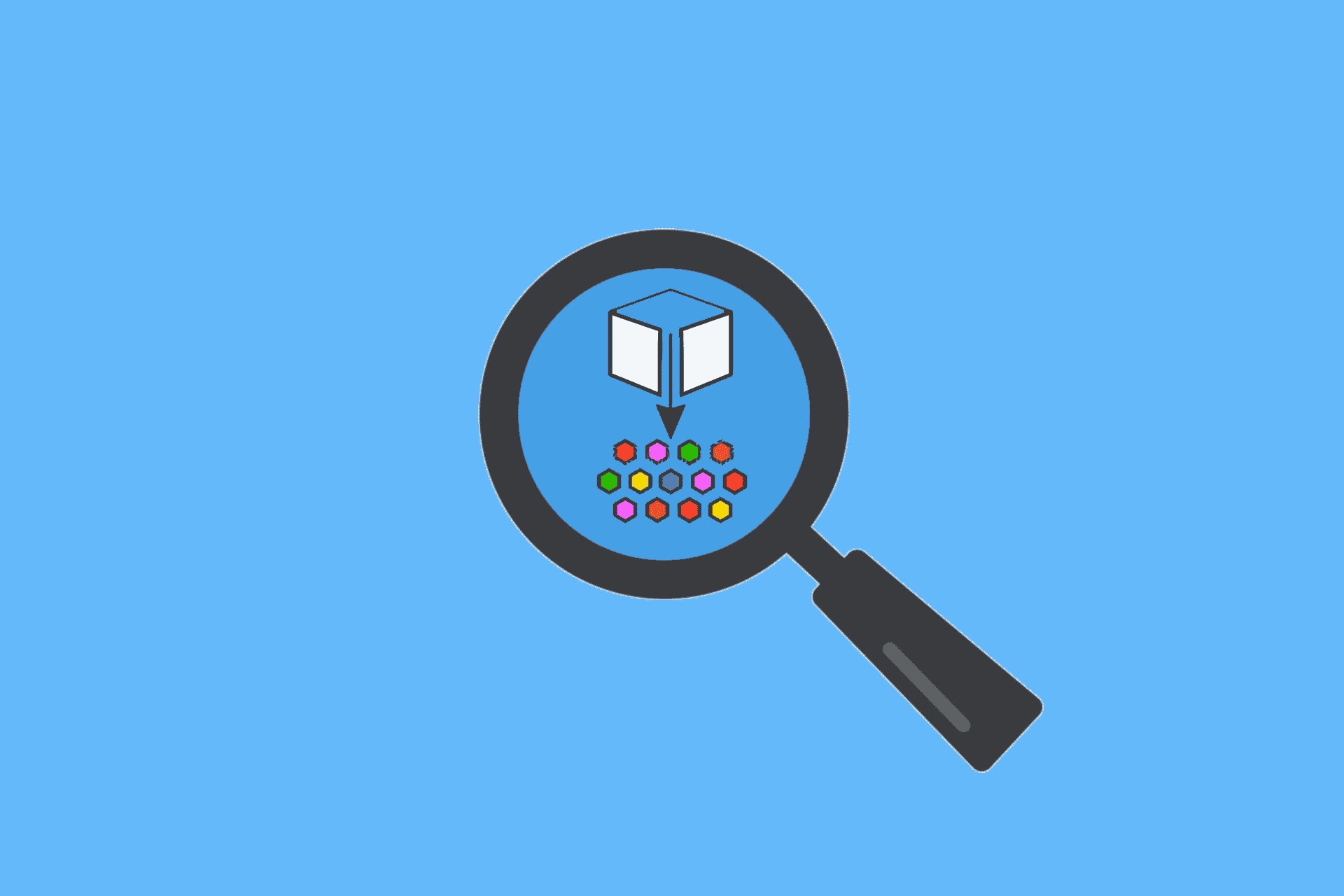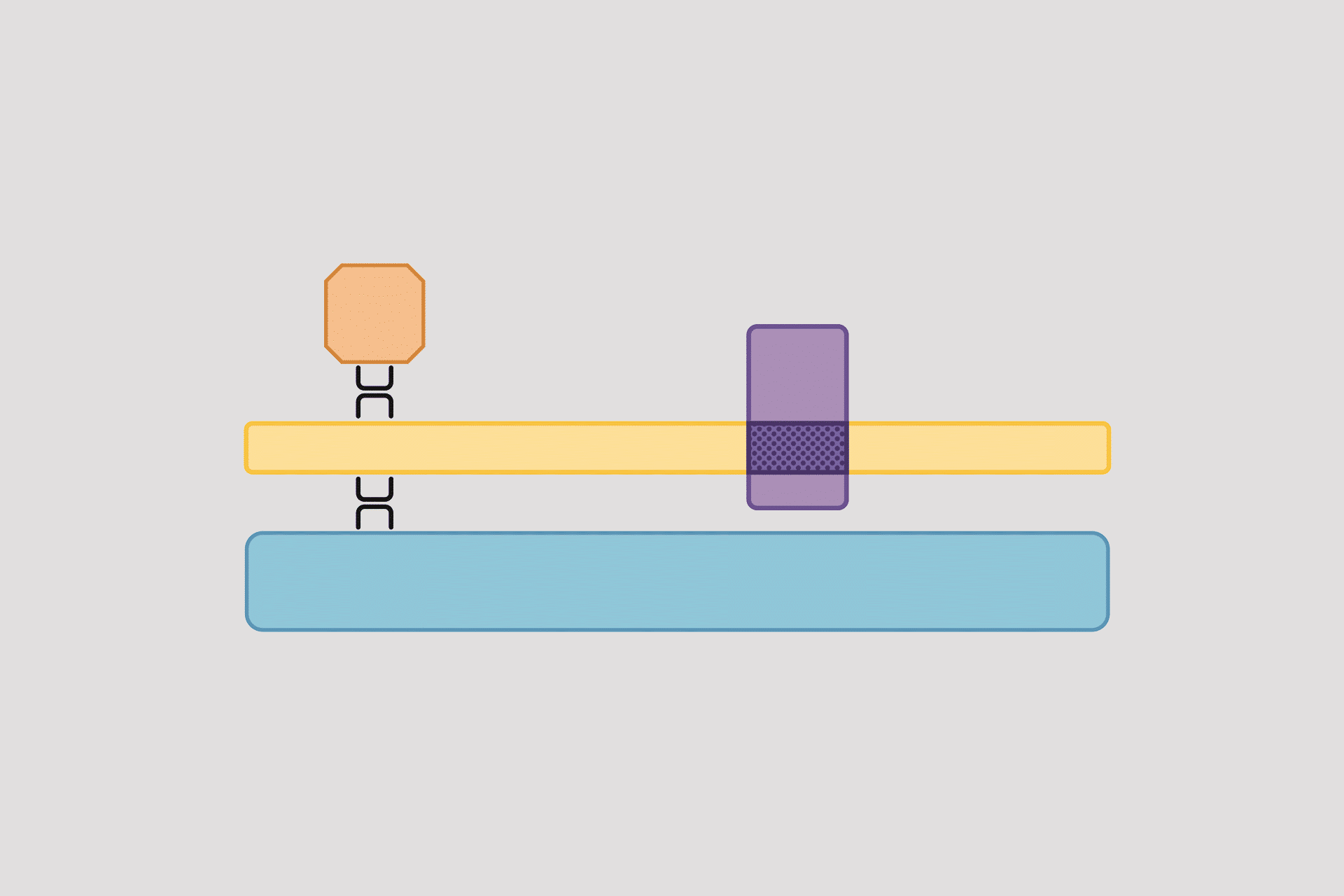Working Learning Gap – Gute Vorsätze reichen nicht
Inhaltsverzeichnis zum Aufklappen und eine Zusammenfassung zum Hören
Was ist der Working Learning Gap?
Wenn gute Vorsätze auf die Realität treffen
Selbstgesteuertes Lernen: Wundermittel oder Missverständnis?
Die Überwindung der Working Learning Gap
Praktische Lösungsansätze für Unternehmen und Mitarbeitende
Fazit und Ausblick: Vor der Schlucht zur Brücke
Neu: t2informatik Blogcast: Working Learning Gap – Gute Vorsätze reichen nicht – eine Zusammenfassung zum Hören in 2:04 Minuten
Warum gute Lernvorsätze im Arbeitsalltag scheitern und was wir dagegen tun können
Montag, 8:00 Uhr, frisch geduscht und voller Tatendrang: „Diese Woche werde ich endlich die neue Software lernen, die seit drei Monaten auf meinem Desktop blinkt wie ein vergessener Weihnachtsbaum.“
Freitag, 17:30 Uhr, müde und erschöpft: Das Icon blinkt immer noch – und Sie haben es diese Woche genau null Mal angeklickt, dafür aber 47 „dringende“ E-Mails beantwortet und in 23 Meetings über Meetings geredet.
Willkommen im Club der gescheiterten Lernvorsätze! Sie sind nicht allein. Tatsächlich sind Sie Mitglied einer sehr exklusiven, aber leider viel zu großen Gemeinschaft von Menschen, die unter dem sogenannten Working Learning Gap leiden. Das klingt sehr wissenschaftlich und wichtig, beschreibt aber eigentlich nur das, was Sie gerade gedacht haben: „Verdammt, schon wieder nicht geschafft.“
Die gute Nachricht? Es liegt nicht an Ihrem Charakter, Ihrer Disziplin oder daran, dass Sie heimlich lieber Katzenvideos schauen (obwohl die wirklich sehr lehrreich sein können). Es liegt am System und Systeme kann man ändern.
Was ist der Working Learning Gap?
Stellen Sie sich vor, Sie stehen vor einer Schlucht. Auf der einen Seite steht ein Schild: „Arbeiten“ – dort warten Ihre täglichen Aufgaben, die brennenden Deadlines, die Kollegin, die „nur mal schnell eine Frage“ hat, und natürlich der Chef, der sich wundert, warum das Projekt noch nicht fertig ist. Auf der anderen Seite steht ein anderes Schild: „Lernen“ – dort warten spannende neue Fähigkeiten, innovative Ansätze und das gute Gefühl, endlich mal wieder etwas Neues zu verstehen.
Zwischen beiden Seiten klafft eine tiefe Schlucht: der Working Learning Gap. Und während Sie noch überlegen, wie Sie rüberkommen könnten, ruft jemand von der Arbeitsseite: „Wo bleibst du denn? Hier brennt’s!“ Also springen Sie zurück zu den vertrauten Aufgaben, und die Lernseite wird wieder um einen Tag verschoben.
Das Gemeine daran: Im Gegensatz zu anderen Lern-Problemen geht es hier nicht darum, dass Sie in der Schule etwas Falsches gelernt haben. Es geht darum, dass Sie durchaus wissen, was Sie lernen müssen, Sie finden nur nicht das wann und wie in Ihrem prallgefüllten Arbeitsalltag.
Der Working Learning Gap ist also die Diskrepanz zwischen der ehrlichen Absicht, sich kontinuierlich weiterzubilden, und der harten Realität eines Terminkalenders, der aussieht wie ein Tetris-Spiel kurz vor dem Game Over. Und anders als beim privaten Lernen, wo Sie abends auf der Couch entscheiden können, ob Sie lieber Netflix schauen oder einen Online-Kurs belegen, steht hier Ihre berufliche Zukunft auf dem Spiel.
Wenn gute Vorsätze auf die Realität treffen
Um zu verstehen, wie tückisch dieser Working Learning Gap ist, schauen wir uns mal einen typischen Tag im Büro an – nennen wir unseren Protagonisten Max Mustermann (ein Name, so kreativ wie seine Lernpläne nachhaltig sind).
Max arbeitet in der IT-Abteilung eines mittelständischen Unternehmens. Sein Job: Das Unternehmen technisch am Laufen halten. Klingt einfach, oder? Das Problem: Die Software-Welt dreht sich schneller als ein Hamster im Laufrad nach drei Espresso. Jeden Tag gibt es neue Updates, Features, Tools – und Max soll natürlich immer auf dem neuesten Stand sein.
Montag, 7:55 Uhr: Max startet nach einem erholsamen Wochenende motiviert seinen Computer und sieht 17 neue Benachrichtigungen über Updates. „Super“, denkt er, „heute Vormittag arbeite ich mich da mal durch.“
Montag, 8:03 Uhr: „Max, kannst du mal eben schauen? Mein Computer macht komische Geräusche.“ (Es ist der Lüfter. Es ist immer der Lüfter.)
Montag, 11:47 Uhr: Nach vier weiteren „nur mal eben“-Anfragen schafft es Max endlich an seinen Schreibtisch zurück. Auch das tolle Ticketsystem hilft da nicht wirklich. Die Updates warten noch. Aber jetzt ist ja auch schon fast Mittagspause…
Montag, 14:30 Uhr: „Max, wir müssen unbedingt über das neue Projekt sprechen!“ Sein Chef hat Verständnis für seine Arbeit, die Priorisierung der Anfragen, ganz anders als der Fachbereich, der das Projekt beauftragt hat. Also Meeting bis 16:00 Uhr. Danach noch zwei Tickets bearbeiten, die als „dringend“ markiert sind.
Montag, 17:45 Uhr: Max schaut auf die immer noch ungelesenen Update-Benachrichtigungen. „Morgen“, denkt er. „Morgen ganz bestimmt.“
Diese Geschichte wiederholt sich täglich – nicht nur bei Max, sondern bei Millionen von Berufstätigen weltweit. Das Paradoxe daran: Je wichtiger kontinuierliches Lernen wird (und es wird immer wichtiger, auch oder gerade in Zeiten von KI), desto schwieriger wird es, Zeit dafür zu finden. Es ist, als würde man versuchen, ein Buch zu lesen, während jemand permanent das Licht an- und ausschaltet und das immer lautstark kommentiert.
Besonders bitter wird es, wenn Max dann auf Konferenzen geht – in der Hoffnung, dort endlich mal Input zu bekommen. Aber statt inspirierender Vorträge über die neuesten Technologien hört er in den Kaffeepausen immer wieder dasselbe: „Ich komme einfach nicht mehr mit. Die Entwicklungen sind so schnell, ich weiß gar nicht, womit ich anfangen soll.“ Und alle nicken verständnisvoll, denn alle kennen das Problem.
Selbstgesteuertes Lernen: Wundermittel oder Missverständnis?
Und dann kommt sie, die vermeintliche Lösung aller Probleme: Selbstgesteuertes Lernen!
Der Begriff klingt modern, effizient und vor allem: kostengünstig. Viele Unternehmen haben ihn für sich entdeckt und sind überrascht von dem, was sie da eigentlich gefunden haben.
Missverständnis Nr. 1: Der Sparfuchs-Ansatz
Die Denkweise: „Warum teure Trainer engagieren, wenn unsere Mitarbeiter auch selbst lernen können? Die sind doch alle erwachsen und motiviert!“
Die Realität: Max bekommt Zugang zu einer E-Learning-Plattform mit 2.847 Kursen und der freundlichen Mitteilung: „Suchen Sie sich aus, was für Sie relevant ist. Sie haben ja jetzt die Freiheit, selbstgesteuert zu lernen!“
Max schaut auf die Kursliste wie ein Reh ins Scheinwerferlicht. Wo soll er anfangen? Was ist wirklich wichtig? Und wann soll er das alles machen zwischen den „nur mal eben“-Anfragen und den dringenden Tickets?
Das Ergebnis: Max klickt sich einmal durch die Plattform, markiert drei Kurse und öffnet sie nie wieder. Das Unternehmen spart (scheinbar) Geld, Max lernt nichts, und alle sind frustriert. Mission erfolgreich gescheitert.
Missverständnis Nr. 2: Die Selbstorganisations-Falle
Noch perfider ist die Vorstellung, selbstgesteuertes Lernen könne gleich zwei Probleme auf einmal lösen:
- Problem A (Individuell): Max ist schlecht organisiert und kann seine Lernzeit nicht managen.
- Problem B (Organisational): Max arbeitet gleichzeitig an fünf Projekten, hat keine Ahnung, wie viel Prozent seiner Zeit er wo investieren soll, und bekommt täglich neue „dringende“ Aufgaben, die alles andere verdrängen.
Die vermeintliche Lösung: „Max muss lernen, sich selbst zu organisieren!“
Das ist, als würde man jemandem, der in einem brennenden Haus steht, raten, er solle einfach besseres Zeitmanagement lernen, um in Ruhe die Löscharbeiten zu planen. Selbstorganisation kann Max nicht dabei helfen, dass sein Chef ihm täglich neue Prioritäten vor die Nase setzt oder dass in seinem Kalender seit drei Monaten kein einziger freier Slot mehr zu finden ist.
Die Überwindung der Working Learning Gap
Hier kommt eine revolutionäre Idee: Was, wenn Lernen gar nicht einsam sein muss? Was, wenn es sogar besser funktioniert, wenn man es nicht alleine macht?
Der Effizienz-Effektivitäts-Twist
Stellen Sie sich vor, Max lernt super effizient. Er steht jeden Tag um 6:00 Uhr auf, macht seinen Online-Kurs und eignet sich neues Wissen an. Nach einem Monat ist er ein Experte für das neue Tool. Mission erfüllt!
Aber Moment, was ist mit seinen vier Kollegen, die das gleiche Tool auch brauchen? Die machen parallel ihre eigenen Kurse, stolpern über die gleichen Probleme und finden (hoffentlich) die gleichen Lösungen. Fünf Menschen, fünf Mal die gleiche Arbeit. Das ist effizient für den Einzelnen, aber ziemlich ineffektiv für das Team.
Bessere Idee: Max lernt das Tool und erklärt es anschließend seinen Kollegen. Warum ist das genial?
- Max versteht es besser: Wer anderen etwas erklärt, muss es wirklich durchdacht haben. (Probieren Sie mal, jemandem zu erklären, wie man Fahrrad fährt, Sie werden überrascht sein, was Sie alles nicht bewusst wissen.)
- Die Kollegen lernen schneller: Eine halbe Stunde Erklärung von jemandem, der gerade die gleichen Probleme hatte, ist oft mehr wert als drei Stunden Video-Tutorial.
- Das Team wird stärker: Gemeinsames Wissen schweißt zusammen und sorgt dafür, dass nicht alles zusammenbricht, wenn Max im Urlaub ist.
Das Ende der Schulungs-Belohnung
Früher war es so: „Max, du warst dieses Jahr besonders fleißig und hast tollen Einsatz gezeigt. Zur Belohnung darfst du auf die teure Konferenz (wahlweise auch Expertenschulung) nach München!“ Max fuhr hin, hörte interessante Vorträge, aß gut und kam mit einem Stapel Ideen (sowie 1,5 Kilo mehr auf der Waage) und guter Vorsätze zurück.
Was passierte mit seinem neuen Wissen? Es verschwand in seinem Kopf wie Urlaubsfotos auf einer vergessenen Festplatte. Das Unternehmen hatte viel Geld ausgegeben, Max hatte schöne Tage, aber nachhaltig profitiert hat niemand.
Neue Regel: Wer lernt, teilt. Max geht zur Konferenz (Schulung) und berichtet anschließend dem Team. Er fasst die wichtigsten Erkenntnisse zusammen, diskutiert sie mit den Kollegen und überlegt gemeinsam, was davon im Unternehmen umgesetzt werden kann. Das persönliche Ziel aus Max‘ Jahresendgespräch heißt dann nicht „Besuch der Konferenz xyz.“ Sondern „Erarbeitung eines Plans und Teilen des Wissens zum Thema abc mit den Kollegen.“
Plötzlich wird aus einer Einzelinvestition ein Multiplikator-Effekt. Und Max? Der versteht die Inhalte durch das Erklären und Diskutieren viel besser, als wenn er nur passiv zugehört hätte.
Selbstorganisation braucht Organisation
Das klingt paradox, ist aber wahr: Damit Menschen selbstorganisiert lernen können, muss jemand die Organisation dafür schaffen. Es ist wie bei agilen Teams: die sind auch nicht einfach plötzlich selbstorganisiert, sondern brauchen einen Rahmen, Regeln und manchmal einen Scrum Master, der aufpasst, dass der Rahmen eingehalten wird. Denn Selbstorganisation braucht (oh Wunder!) auch Führung.
Für selbstgesteuertes Lernen bedeutet das: Jemand muss Lernzeiten blocken, Lerngruppen moderieren und dafür sorgen, dass „Lernen“ nicht das erste ist, was gestrichen wird, wenn ein Projekt brenzlig wird. Das ist eine moderne Führungsaufgabe zur Überwindung der Working Learning Gap, oder?
Praktische Lösungsansätze für Unternehmen und Mitarbeitende
Genug der (humorvollen) Theorie, was können Sie konkret tun? Hier sind ein paar Ansätze, die tatsächlich funktionieren (und die Sie nicht schon auf 47 anderen Produktivitätsbeiträgen gelesen haben):
Für Führungskräfte: Vom Lippenbekenntnis zur Lernkultur
1. Lernzeit ist Arbeitszeit – Punkt!: Hören Sie auf zu sagen: „Lernt doch einfach nebenbei.“ Das ist wie: „Atmet doch einfach nebenbei, während ihr unter Wasser seid.“ Blockieren Sie (für ihre Mitarbeitenden) echte Lernzeiten im Kalender und verteidigen Sie sie gegen alle „dringenden“ Anfragen und Projekte.
2. Der Produktentwicklungs-Trick: Ein cleverer Manager hat mal seinen Mitarbeitern gesagt: „Ihr habt alle auch den Job, unsere Prozesse und Tools weiterzuentwickeln. Dafür braucht ihr Lernzeit.“ Plötzlich war Lernen kein „Nice-to-have“ mehr, sondern ein offizieller Arbeitsauftrag. Genial, oder?
3. Projektbelastung real machen: Wenn Max gleichzeitig an fünf Projekten arbeitet und nebenbei noch lernen soll, ist das kein Selbstorganisationsproblem, das ist schlechte Personalplanung (aka Führungsschwäche). Machen Sie eine ehrliche Inventur: Wer arbeitet wieviel Prozent an welchen Projekten? Sie werden überrascht sein und hoffentlich Maßnahmen ableiten.
4. Lerngruppen mit System: Bilden Sie Teams, die sich regelmäßig über neue Erkenntnisse austauschen. Aber nicht als zusätzlichen Termin, sondern als festen Bestandteil bestehender Meetings. 15 Minuten „Was haben wir diese Woche gelernt?“ können Wunder wirken. Mit dieser Einstellung wird der Working Learning Gap Woche für Woche kleiner.
Für Mitarbeitende: Von der Opferrolle zum Lern-Helden
1. Der Kategorie-Hack: Statt zu sagen „Ich muss noch dieses Tool lernen“, schaffen Sie sich eine übergeordnete Kategorie. Zum Beispiel: „Ich entwickle unsere Kundenbetreuung weiter.“ Plötzlich ist Lernen kein isoliertes Add-on mehr, sondern Teil eines größeren, wichtigen Projekts. Wichtig bleibt es dann trotzdem, das übergeordnete Ziel in kleinere Zwischenziele herunterzubrechen.
2. Die 15-Minuten-Regel: Vergessen Sie die großen Lernblöcke, die funktionieren eh nicht. Stattdessen: Jeden Tag 15 Minuten, bevor Sie die E-Mails öffnen! In einem Jahr sind das über 60 Stunden Lernzeit. Und 15 Minuten sind so kurz, dass sie niemand als „Faulheit“ interpretieren kann.
3. Lernen durch Erklären: Suchen Sie sich einen Lernpartner und erklären Sie sich gegenseitig neue Konzepte. Das funktioniert sogar per Video-Call, wenn Sie im Homeoffice sind. Zwei Menschen, doppelter Lernerfolg, halber Zeitaufwand.
4. Die Experiment-Haltung: Hören Sie auf, Lernen als schwere Pflicht zu sehen. Sehen Sie es als Experiment: „Mal schauen, ob das funktioniert.“ Experimente dürfen schiefgehen, das ist der ganze Punkt. Dabei hilft es ungemein, wenn man für das Experiment eine Hypothese formuliert. Die gilt es zu beweisen. Wenn nicht ist es auch kein Problem: Es gibt trotzdem ein Ergebnis. Und wenn’s mal richtig schiefgeht? Auch gut! Jede Bruchlandung ist Training für resilientere Flügel.
Für alle: Strukturelle Veränderungen
1. Fehlerkultur entwickeln: Schaffen Sie eine Atmosphäre, in der es okay ist zu sagen: „Das kenne ich noch nicht, aber ich kann es lernen.“ Nichts tötet Lernmotivation so effektiv wie die Angst, als unwissend dazustehen.
2. Reflexionsrituale einführen: Einmal im Monat, 30 Minuten: Was haben wir gelernt? Was hat funktioniert? Was nicht? Wo sind wir in die Working-Learning-Gap-Falle getappt? Ehrliche Reflexion ohne Schuldzuweisungen. Und bitte: Das monatliche Lernen-über-Lernen ist keine Kaffeerunde, es ist der Pulsgeber Ihrer Lernkultur.
3. Lernzeit messen: Was gemessen wird, wird gemacht. Aber Vorsicht: Messen Sie nicht die Stunden auf der Lernplattform, sondern den tatsächlichen Wissenstransfer. Hat Max nach seinem Kurs drei Kollegen das neue Tool erklärt? Das ist ein Erfolg!
Fazit und Ausblick: Von der Schlucht zur Brücke
Der Working Learning Gap ist real, lästig und frustrierend, aber er ist nicht unüberwindbar. Das Problem liegt nicht daran, dass Menschen faul sind oder keine Lust auf Lernen haben. Es liegt an Systemen, die Lernen als Luxus behandeln, obwohl es längst eine Notwendigkeit geworden ist.
Die gute Nachricht: Systeme kann man ändern. Es braucht nur den Mut, ehrlich hinzuschauen und festzustellen: „Okay, unser aktueller Ansatz funktioniert nicht. Lass uns was Neues versuchen.“ Wenn Lernen Teil der DNA Ihres Unternehmens (oder Ihrer Abteilung bzw. Teams) wird, sind Weiterentwicklung und Anpassungsfähigkeit keine Zusatzfeatures mehr, sondern Betriebssystem.
Die noch bessere Nachricht: Sie müssen nicht warten, bis Ihr Unternehmen oder Ihr Chef das Problem löst. Sie können heute anfangen – mit 15 Minuten, einem Lernpartner oder der einfachen Entscheidung, das nächste Mal, wenn Sie etwas Neues lernen, es einer Kollegin zu erklären.
Der Working Learning Gap ist eine Schlucht, aber Schluchten kann man überbrücken. Es braucht nur die richtigen Materialien, ein bisschen Planung und die Erkenntnis, dass man Brücken am besten gemeinsam baut.
Und wer weiß? Vielleicht schauen Sie in einem Jahr zurück und denken: „Komisch, früher fand ich Lernen immer so schwierig. Heute ist es einfach Teil meines Alltags.“
Hinweise:
PS: Falls Sie diesen Artikel bis zum Ende gelesen haben, haben Sie übrigens gerade etwa 15 Minuten investiert, um etwas über Lernen zu lernen. Sehen Sie? Es funktioniert bereits!
Und wenn Sie Lust haben: Hier ist eine informative Podcast-Episode von Dierk Söllner mit Simon Qualmann als weiterführende Inspiration: https://www.dierksoellner.de/lebenslanges-lernen-ganz-nebenbei/
Wollen Sie als Multiplikatorin oder Meinungsführer über die Überwindung der Working Learning Gap diskutieren? Dann teilen Sie diesen Beitrag in Ihrem Netzwerk. Und falls Sie sich für weitere Tipps aus der Praxis interessieren, dann abonnieren Sie unseren beliebten Newsletter.
Dierk Söllner hat weitere Beiträge im t2informatik Blog veröffentlicht, u. a.

Dierk Söllner
Die Vision von Dierk Söllner lautet: „Menschen und Teams stärken – empathisch und kompetent“. Als zertifizierter Business Coach (dvct e.V.) unterstützt er Teams sowie Fach- und Führungskräfte bei aktuellen Herausforderungen durch professionelles Coaching. Kombiniert mit seiner langjährigen und umfassenden fachlichen Expertise in IT-Methodenframeworks macht ihn das zu einem kompetenten und empathischen Begleiter bei Personal-, Team und Organisationsentwicklung. Er betreibt den Podcast „Business Akupunktur„, hat einen Lehrauftrag zu „Moderne Gestaltungsmöglichkeiten hoch performanter IT-Organisationen“ an der NORDAKADEMIE Hamburg und das Fachbuch „IT-Service Management mit FitSM“ publiziert.
Seine Kunden reichen vom DAX-Konzern über mittelständische Unternehmen bis zu kleineren IT-Dienstleistern. Er twittert gerne und veröffentlicht regelmäßig Fachbeiträge in Print- und Online-Medien. Gemeinsam mit anderen Experten hat er die Initiative „Value Stream“ gegründet.
Im t2informatik Blog veröffentlichen wir Beträge für Menschen in Organisationen. Für diese Menschen entwickeln und modernisieren wir Software. Pragmatisch. ✔️ Persönlich. ✔️ Professionell. ✔️ Ein Klick hier und Sie erfahren mehr.