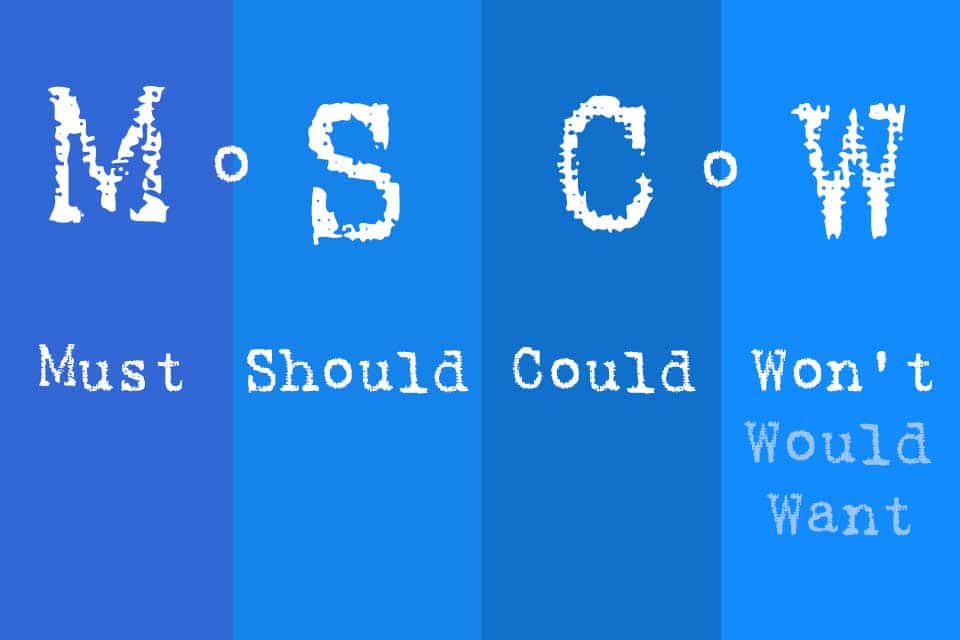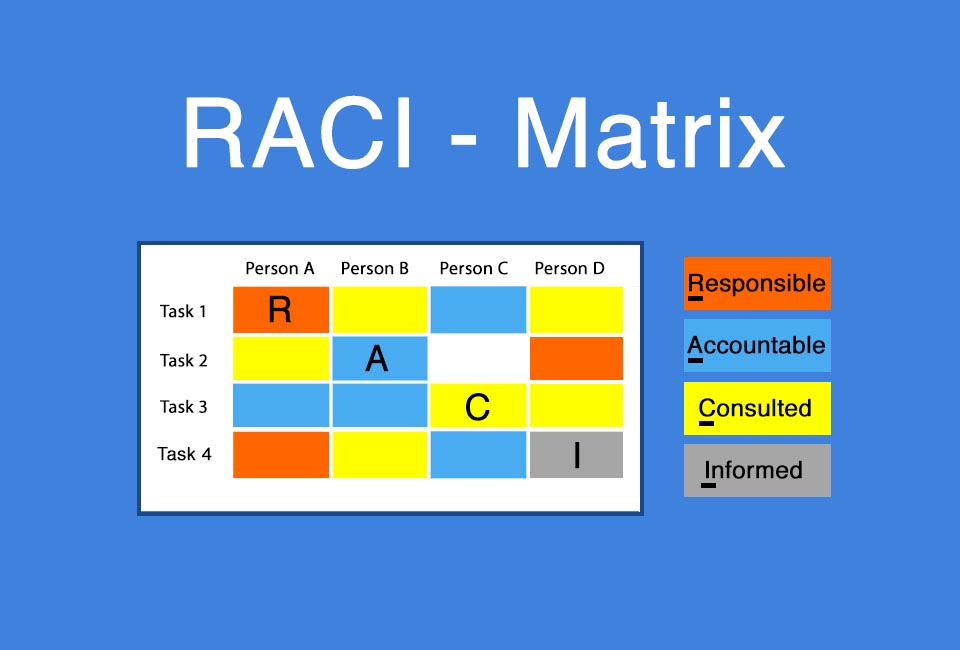ICE-Scoring
Inhaltsverzeichnis: Definition – Kriterien – Vorteile und Nachteile – Fragen aus der Praxis – Hinweise
ICE-Scoring – Priorisierung auf Basis von Auswirkung, Zuversicht und Einfachheit
In dynamischen Teams und wachsenden Unternehmen entstehen oft zahlreiche Ideen gleichzeitig, sei es für neue Produkte, Marketingaktionen oder Verbesserungen interner Abläufe. Doch nicht jede Idee lässt sich sofort umsetzen und nicht jede entfaltet den gewünschten Nutzen. Umso wichtiger ist es, begrenzte Zeit und Ressourcen auf die Vorhaben zu lenken, die den größten Mehrwert versprechen. Genau hier setzt ICE-Scoring an.
Das ICE-Scoring-Modell ist eine einfache, gleichzeitig wirkungsvolle Methode, um Ideen, Features oder Projekte zu bewerten und sinnvoll zu priorisieren. Entwickelt wurde es von Sean Ellis, um Entscheidungsprozesse zu vereinfachen und Teams dabei zu unterstützen, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. [1] ICE ist ein Akronym und steht für Impact (Auswirkung), Confidence (Zuversicht) und Ease (Leichtigkeit). Mit diesen drei Kriterien lässt sich jede Idee schnell einschätzen und miteinander vergleichen.
ICE-Scoring-Kriterien im Detail
Jedes der drei Kriterien Impact, Confidence und Ease wird mit einem numerischen Wert bewertet, meist auf einer Skala von 1 bis 5 oder 1 bis 10.
- Impact (Auswirkung) beschreibt den potenziellen positiven Effekt, den eine Idee für das Unternehmen oder die Nutzer haben kann. Ein hoher Wert signalisiert eine starke Verbesserung, zum Beispiel eine deutliche Umsatzsteigerung oder wachsende Kundenzufriedenheit.
- Confidence (Zuversicht) misst, wie sicher man sich ist, dass die geschätzten Auswirkungen tatsächlich eintreten und die Umsetzung wie geplant möglich ist. Die Bewertung stützt sich dabei auf vorhandene Daten, Erfahrungswerte oder klare Zielvorgaben.
- Ease (Leichtigkeit) zeigt an, wie einfach und ressourcenschonend sich eine Idee umsetzen lässt. Berücksichtigt werden dabei Aufwand, Kosten, Zeit und benötigtes Personal oder Technologie. Ein hoher Wert bedeutet, dass die Umsetzung unkompliziert ist, während ein niedriger Wert auf hohe Komplexität hinweist.
Der ICE-Score ergibt sich, indem die Werte für Impact, Confidence und Ease miteinander multipliziert werden: ICE-Score = Impact × Confidence × Ease.
Alternativ können die drei Werte auch addiert werden, üblich ist jedoch die Multiplikation, da sie die Unterschiede deutlicher sichtbar macht. Ein hoher ICE-Score zeigt an, dass eine Idee besonders vielversprechend ist und priorisiert werden sollte. So entsteht eine klare Rangfolge der möglichen Initiativen.
Vorteile und Nachteile von ICE-Scoring
ICE-Scoring hat verschiedene Vorteile für die Priorisierung von Ideen, Features oder Projekten:
- Er bietet eine klare Struktur, die hilft, komplexe Entscheidungen greifbarer zu machen. So wird die Bewertung von Projekten und Ideen durch eine einheitliche Methode nachvollziehbar gestaltet.
- Statt nur auf Bauchgefühl zu setzen, liefert der Score eine greifbare, quantitative Grundlage. Ideen werden nicht mehr rein subjektiv diskutiert, sondern anhand einer Zahl vergleichbar gemacht.
- Die Methode ist leicht verständlich und schnell anzuwenden. Dadurch lassen sich auch in dynamischen Teams rasch Prioritäten festlegen, ohne lange Vorbereitungsphasen.
- Im Mittelpunkt stehen die wichtigsten Erfolgsfaktoren einer Idee: Welchen Wert sie hat, wie sicher die Annahmen sind und wie groß der Aufwand ist.
- Am Ende entsteht eine übersichtliche Rangliste. Das vereinfacht es, sich für die nächsten Schritte zu entscheiden und Diskussionen im Team zu verkürzen.
Allerdings bringt ICE-Scoring auch einige Nachteile bzw. Herausforderungen mit sich:
- Die Bewertung der Kriterien hängt trotz klarer Skala immer von der persönlichen Einschätzung ab. Verschiedene Personen können zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen.
- Die Berechnung zeigt nur den aktuellen Stand, also eine Momentaufnahme. Veränderungen am Markt oder neue Informationen können leicht zu einer veränderten Bewertung und somit zu einer neuen Priorisierung führen.
- Auch wenn die Methode schnell ist, braucht es dennoch Zeit und Ressourcen, um Ideen zu sammeln, zu diskutieren und zu bewerten.
- Ein hoher ICE-Score bedeutet nicht automatisch, dass ein Projekt erfolgreich sein wird. Er zeigt lediglich ein gutes Verhältnis von erwarteter Wirkung, Sicherheit und Aufwand. [2]
Trotz dieser Herausforderungen bleibt das ICE-Scoring eine bewährte Methode, um schnell Struktur in viele Ideen zu bringen und Entscheidungen zu erleichtern. Wichtig ist, den Score regelmäßig zu hinterfragen und bei neuen Erkenntnissen anzupassen.
Fragen aus der Praxis
Hier finden Sie einige Fragen und Antworten aus der Praxis:
Für welche Anwendungsfällt eignet sich das ICE-Scoring besonders gut oder weniger gut?
Das ICE-Scoring eignet sich besonders gut, wenn viele Ideen oder Projekte schnell und pragmatisch bewertet werden sollen. Es ist ideal, um eine Vielzahl von Optionen übersichtlich zu ordnen und zügig Entscheidungen zu treffen, etwa bei der Auswahl von Produktfeatures, Marketingaktionen oder Innovationsvorhaben. In agilen Entwicklungsumgebungen wird die Methode bspw. im Zuge der Sprintplanung bei der Priorisierung von Backlogitems genutzt. Besonders hilfreich ist ICE-Scoring auch in frühen Phasen der Produktentwicklung, wenn erst wenige Daten vorliegen und schnelle Entscheidungen notwendig sind, um den Fortschritt zu sichern und Dynamik zu schaffen. Selbst einfache Aufgabenlisten oder Maßnahmen nach Mitarbeiterbefragungen lassen sich mit dem Ansatz sinnvoll strukturieren und priorisieren.
Weniger geeignet ist ICE-Scoring hingegen für komplexe, strategisch bedeutsame Großprojekte, bei denen viele Abhängigkeiten, Risiken oder detaillierte Ressourcenfragen berücksichtigt werden müssen. Auch bei Entscheidungen mit hoher Tragweite oder großem finanziellen Risiko stößt die Methode an ihre Grenzen, weil sie Unsicherheiten nur eingeschränkt abbildet und auf einfachen, subjektiven Bewertungen beruht. Wo eine objektive, detaillierte Analyse notwendig ist, etwa wenn viele Stakeholder einbezogen werden müssen oder exakte Wirtschaftlichkeitsberechnungen gefragt sind, sind umfassendere Ansätze wie ein Weighted Scoring Model oder fundierte Business-Case-Analysen meist die bessere Wahl.
Zusammengefasst ist ICE-Scoring ein schnelles und leicht anwendbares Werkzeug für dynamische Umgebungen mit überschaubarem Risiko. Für komplexe, langfristige oder strategisch weitreichende Entscheidungen sollte es jedoch durch tiefere Analysen oder ergänzende Methoden ergänzt werden.
Welchen Unterschied macht es, ob die ICE-Scoring-Kriterien addiert oder multipliziert werden?
Der Unterschied zwischen Addition und Multiplikation beim ICE-Scoring liegt in der Wirkung der Kriterien auf den Gesamtscore und in der Spannweite der möglichen Ergebnisse.
Wenn die Werte addiert werden, wirken Impact, Confidence und Ease unabhängig voneinander und gleichen sich linear aus. Selbst wenn ein Kriterium sehr niedrig bewertet wird, kann eine Idee durch hohe Werte bei den anderen Kriterien immer noch einen relativ hohen Gesamtscore erreichen. Schwächen in einem Bereich werden also durch Stärken in anderen Bereichen ausgeglichen. Das kann dazu führen, dass Projekte mit gravierenden Nachteilen trotzdem eine hohe Priorität erhalten.
Die Multiplikation sorgt hingegen dafür, dass sich die Kriterien gegenseitig verstärken oder abschwächen. Ein sehr niedriger Wert in einem Kriterium zieht den gesamten Score deutlich nach unten, egal wie hoch die anderen beiden sind. Damit stellt die Multiplikation sicher, dass eine Idee nur dann einen hohen Score erreicht, wenn alle drei Faktoren mindestens solide bewertet sind.
Ein weiterer Vorteil der Multiplikation ist die größere Spannweite der möglichen Ergebnisse. Bei einer Skala von 1 bis 10 reicht die Addition nur von 3 bis 30. Bei der Multiplikation liegt der Bereich dagegen zwischen 1 (1 × 1 × 1) und 1000 (10 × 10 × 10). Dadurch entstehen größere Abstände zwischen den Scores, was die Unterschiede deutlicher sichtbar macht und eine klarere Rangfolge ermöglicht.
Zusammengefasst: Die Multiplikation verhindert, dass Schwächen ausgeblendet werden, und schafft durch die größere Varianz eine feinere Unterscheidung. So lassen sich wirklich vielversprechende Ideen einfacher erkennen und besser priorisieren.
Was ist das RICE-Scoring?
RICE-Scoring ist eine erweiterte Form des ICE-Scorings und steht für Reach, Impact, Confidence und Effort. Dabei beschreibt Reach, wie viele Personen, Nutzer oder Einheiten von einer Maßnahme profitieren oder betroffen sind. Reach kann dabei unterschiedlich interpretiert werden:
- Es kann die Anzahl der betroffenen Nutzer sein,
- die Zahl der Interaktionen wie Klicks oder Bestellungen,
- ein konkretes Marktpotenzial oder auch
- eine zeitlich definierte Reichweite, etwa „wie viele Nutzer pro Monat“.
Wichtig ist, dass Reach immer messbar gemacht wird, um den Score nachvollziehbar zu halten.
Impact bewertet die Stärke des erwarteten Effekts, Confidence gibt an, wie sicher man sich bei den Schätzungen ist, und Effort beschreibt den Aufwand, der zur Umsetzung nötig ist.
Dass im RICE-Scoring Ease durch Effort ersetzt wird, hat einen klaren Grund: Beide Kriterien beschreiben im Kern den Aufwand — aber aus unterschiedlicher Perspektive.
Beim ICE-Scoring wird mit Ease bewertet, wie leicht etwas umzusetzen ist. Ein hoher Ease-Wert bedeutet: wenig Aufwand, schnelle Umsetzung, geringe Komplexität. Ease ist also positiv formuliert: je höher, desto besser.
Im RICE-Scoring wird dieser Aspekt umgedreht und konkreter gemacht: Statt die Leichtigkeit zu bewerten, wird der tatsächliche Aufwand als Effort direkt gemessen, meist in Personenmonaten, Stunden oder ähnlichen Einheiten. Effort ist also eine realistischere, greifbare Größe. Der Unterschied: Effort fließt als Teiler in die Formel ein. Viel Aufwand verringert den Score, wenig Aufwand steigert ihn.
Der RICE-Score wird berechnet, indem Reach, Impact und Confidence multipliziert und dann durch den Aufwand geteilt werden: RICE = (Reach × Impact × Confidence) / Effort.
Im Vergleich zum ICE-Scoring ermöglicht RICE also eine differenziertere Betrachtung, da es den potenziellen Nutzen direkt ins Verhältnis zum tatsächlichen Aufwand setzt und dabei Reichweite explizit berücksichtigt. Besonders in der Produktentwicklung, bei der Priorisierung von Features oder Roadmaps hilft RICE, Ressourcen gezielter auf die Maßnahmen zu lenken, die mit vertretbarem Aufwand möglichst vielen Nutzern den größten Mehrwert bringen.
Hier erfahren Sie mehr über die Vor- und Nachteile beim RICE-Scoring.
Was ist die PIE-Methode?
PIE steht für:
- Potential (Potenzial): Wie groß ist die potenzielle Verbesserung durch die Umsetzung der Idee? Seiten oder Bereiche mit viel Verbesserungspotenzial erhalten hier höhere Werte.
- Importance (Wichtigkeit): Wie wichtig ist die Seite oder Maßnahme für das Unternehmen? Dies kann sich z.B. am Traffic, an der Conversion-Relevanz oder am Einfluss auf Unternehmensziele orientieren.
- Ease (Leichtigkeit): Wie einfach ist die Umsetzung? Hier fließen technische, organisatorische und politische Faktoren ein. Je leichter umsetzbar, desto höher die Bewertung.
Ähnlich wie beim ICE-Scoring wird jede Idee anhand der drei Kriterien (Potential, Importance, Ease) auf einer Skala (z.B. 1–5 oder 1–10) bewertet. Anschließend werden die Werte dann aber addiert und durch drei geteilt, um einen Durchschnittswert (den PIE-Score) zu erhalten.
Typische Einsatzgebiete sind Website-Optimierung (z.B. welche Seiten oder Features sollten zuerst verbessert werden), A/B-Testing (Priorisierung von Testideen), Conversion-Optimierung oder die Verbesserung von Nutzer-Onboarding oder Checkout-Prozessen.
Impuls zum Diskutieren:
Wie lassen sich persönliche Meinungen bei der Bewertung der Kriterien objektivieren, damit das ICE-Scoring den größtmöglichen Nutzen stiftet?
Hinweise:
[1] Sean Ellis: Hacking Growth: How Today’s Fastest-Growing Companies Drive Breakout Success
[2] Technische Schulden oder langfristige Wartungsprojekte erhalten übrigens oft niedrige Impact-Werte. Das kann dazu führen, dass solche Vorhaben verdrängt werden, obwohl sie für Stabilität und Wachstum wichtig sind.
Die Inhalte auf dieser Seite dürfen Sie gerne teilen oder verlinken. Und falls Sie sich für Tipps aus der Praxis interessieren, dann testen Sie unseren beliebten Newsletter mit neuen Beiträgen, Downloads, Empfehlungen und aktuellem Wissen. Vielleicht wird er auch Ihr Lieblings-Newsletter!
Hier finden Sie weitere Informationen aus unserer Rubrik Wissen kompakt: