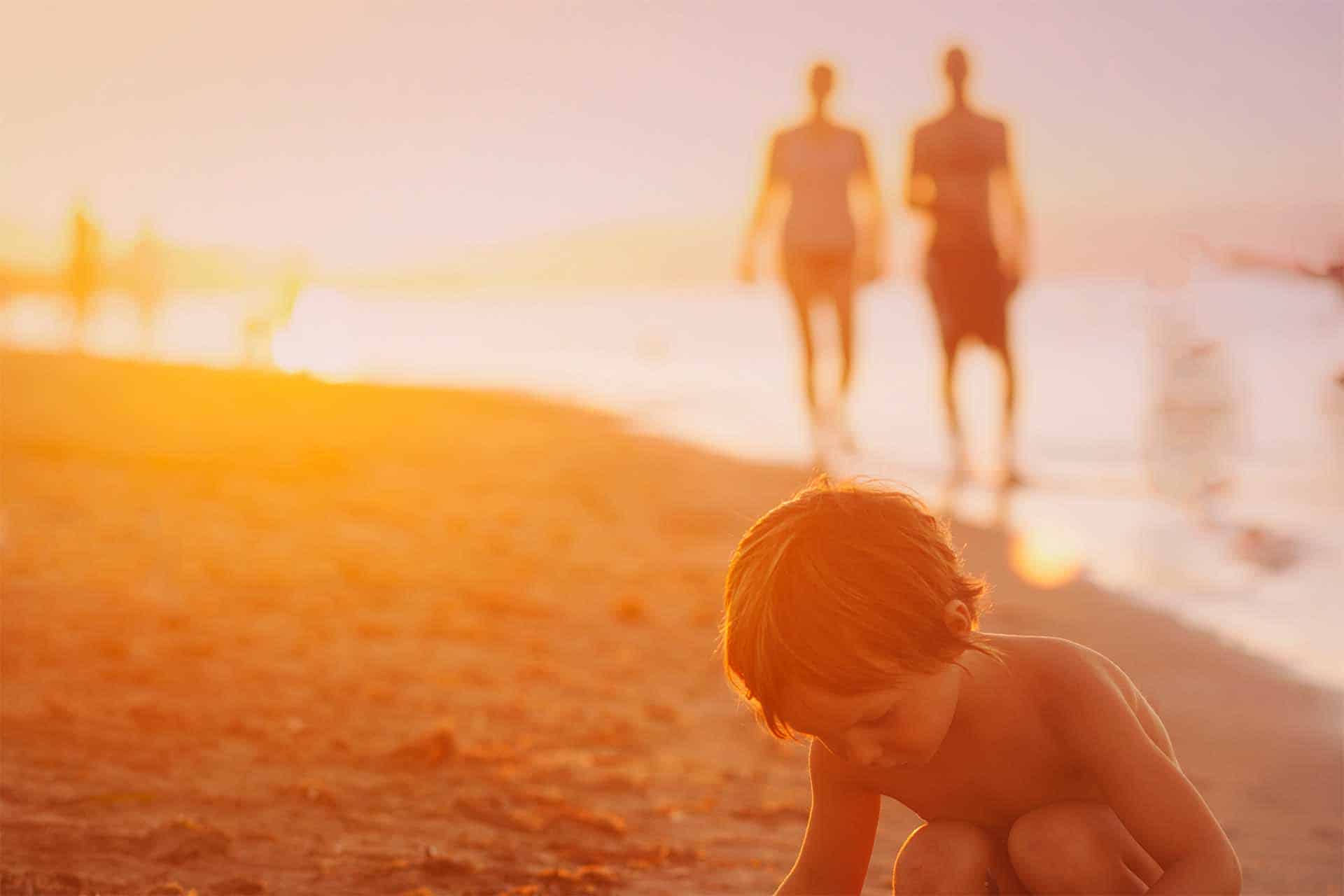Nachhaltigkeit und Open Source
Inhaltsverzeichnis zum Aufklappen
Der blinde Fleck im Nachhaltigkeitsdiskurs
Soziale Nachhaltigkeit
Digitale Nachhaltigkeit – ökologische Perspektive
Digitale Nachhaltigkeit – soziale Perspektive
Open Source – frei, aber nicht zwingend umsonst
Digitale Souveränität fördert digitale Nachhaltigkeit
Digitale Abhängigkeit vs. Open Source
Open Source für alle?
Eigentlich ist die Idee ganz einfach: Wenn man nur so viel Holz schlägt, wie innerhalb eines natürlichen Regenerationszyklus nachwächst, kann man eine sehr lange Zeit Holz nutzen, regelmäßig davon profitieren und den Wert langfristig erhalten.
Die Idee des Forstwirtschaftlers Carl von Carlowitz im 18. Jahrhundert war eine rein wirtschaftliche Entscheidung, die aus einer simplen Erkenntnis heraus getroffen wurde: Wenn der Wald komplett abgeholzt wird, reduziere ich den Wald auf den reinen aktuellen Nutzwert. Das Kapital ist für die nächsten 30 Jahre perdu, bringt für das Unternehmen keine Einnahmen mehr und gesellschaftlich gesehen auch keine Arbeitsplätze. Eine ganze Region blutet aus.
Abgesehen davon ist ein Forst ein Lebensraum und bietet insgesamt deutlich mehr als nur den Verkaufspreis des Holzes: Erholung, Schutz, Schatten, Nahrung, you name it. Carlo von Carlowitz fand in seiner Sylvicultura oeconomica (1713) einen Namen für seine Idee: Nachhaltigkeit.
Von der speziellen zur allgemeinen Begrifflichkeit
Lange Zeit beschränkte sich der Begriff auf die Forstwirtschaft. Erst in den 1980er Jahren mit dem Aufkommen der sogenannten Öko-Bewegung und im Kontext der Publikation „Our Common Future“ (1987, „Brundtland-Bericht“) der Weltkommission für Umwelt und Entwicklung (World Commission on Environment and Development, WCED) entdeckte man ihn wieder. Seitdem wird er als bereichsübergreifender Begriff verwendet:
„Sustainable development is development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs.“¹
Infolge des Brundtland-Berichts entstand 1992 die UN-Konferenz für Umwelt und Entwicklung in Rio de Janeiro, bei der sich Vertreter:innen aus 178 Ländern trafen, um über umwelt- und entwicklungspolitische Fragen im 21. Jahrhundert zu beraten.
„In Rio wurde das Konzept der nachhaltigen Entwicklung als internationales Leitbild anerkannt. Dahinter stand die Erkenntnis, dass wirtschaftliche Effizienz, soziale Gerechtigkeit und die Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen gleichwertige überlebenswichtige Interessen sind, die sich gegenseitig ergänzen.“²
Das Ergebnis der Konferenz war die Agenda 21 – ein Aktionsprogramm, das neue Entwicklungs- und Umweltpartnerschaften zwischen Industrie- und Entwicklungsländern forderte. Darin verpflichteten sich die teilnehmenden Staaten, nationale Nachhaltigkeitsstrategien auszuarbeiten. Deutschland legte erstmals mit „Perspektiven für Deutschland“ (2002) ein Strategiepapier vor, das 2010 mit einem Maßnahmenprogramm ergänzt wurde.
2015 folgte die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung, die von den Mitgliedsstaaten der Vereinten Nationen einstimmig verabschiedet wurde. Die Agenda 2030 beinhaltet 17 Ziele (Sustainable Development Goals, SDGs) für eine sozial, wirtschaftlich und ökologisch nachhaltige Entwicklung. Die 17 Ziele gelten als universal und für alle Länder gleichermaßen.
Der blinde Fleck im Nachhaltigkeitsdiskurs
Obwohl der Begriff Nachhaltigkeit sich schon seit dem Brundtland-Bericht nicht ausschließlich auf den Bereich Ökologie beschränkte, ist es nach wie vor oft so, dass er hauptsächlich mit der ökologischen Nachhaltigkeit assoziiert wird: Wer den Wald retten will, pflanzt Bäume. Wer das Klima retten will, pflanzt Bäume.
In der wissenschaftlichen Auseinandersetzung entwickelten sich zwar verschiedene Nachhaltigkeitsmodelle mit den Bereichen Ökonomie, Ökologie und Soziales, dennoch ist der Bereich Ökologie (ökologische Nachhaltigkeit) mit Abstand am detailliertesten beschrieben. Im Wirtschaftskontext wurden diese Modelle adaptiert und auf die sogenannte freiwillige „Corporate Social Responsibility“ (CSR) oder auch „Corporate Responsibility“ (CR) übertragen. Auch hier dominieren bis heute die Maßnahmen im Bereich Ökologie, wie z.B. Strombezug aus erneuerbaren Energien, Energiesparmaßnahmen, Abfallreduzierungsmaßnahmen, etc. Etwas neueren Datums im CSR-Kontext ist das „Corporate Citizenship“, d.h. Unternehmen verstehen sich als eingebettet in die Gesellschaft und somit auch als Bürger:innen.
Soziale Nachhaltigkeit
Mit „sozial“ sind im unternehmerischen Kontext üblicherweise Maßnahmen zu Themen wie Arbeitsschutz und Arbeitszeitregelungen (beide gesetzlich geregelt) oder auch faire Bezahlung, Inklusion und Diversity gemeint. Wer sich über die gesetzlichen Vorgaben hinaus verantwortlich zeigen will, schließt das betriebliche (ggfs. partizipative) Gesundheitsmanagement und die Fort- und Weiterbildung ein.
Wenig bekannt ist bisher, dass die
- Entwicklung demokratischer Organisationsstrukturen,
- breitgefächerte Mitbestimmungsangebote (Partizipationsangebote),
- eine moderierende Führungskultur,
- Transparenz und
- Fehlerfreundlichkeit
ebenso unter den Begriff soziale Nachhaltigkeit gezählt werden dürfen, weil sie dazu beitragen, Aspekte wie
- Gesundheit,
- Selbstbestimmtheit,
- Würde,
- Entwicklung,
- Chancengleichheit und
- Bildung
zu fördern.
Digitale Nachhaltigkeit – ökologische Perspektive
Mit zunehmender Digitalisierung ist es selbstverständlich notwendig, auch dieses Thema – so weitgefasst man es denken kann – in die Betrachtung von Nachhaltigkeit zu integrieren. Digitale Nachhaltigkeit kann einerseits aus der ökologischen Perspektive betrachtet werden. Das heißt u.a., dass Hardware unter Umweltaspekten untersucht wird:
- Aus welchem Material besteht die Hardware?
- Wieviel Material und Energie wurden bei der Herstellung verwendet?
- Wieviel Energie wird beim Betrieb verbraucht?
- Kann die Hardware recycelt werden?
- Kann der CO2-Ausstoß beim Betrieb gemessen werden?
- Wieviel Feinstaub produziert die Abnutzung beim Betrieb der Hardware?
- Wie lange ist die Lebens- und Nutzungsdauer? Ist sie kabelgebunden oder mobil nutzbar?
Auch Software kann aus der Umweltperspektive betrachtet werden:
- Ist der Code so geschrieben, dass er energieintensive Interaktionen mit anderer Software eher fördert als reduziert?
- Wieviel Datenmüll, der den Energieverbrauch erhöht, erzeugt der Code?
- Wurde die Software ressourcenschonend entwickelt?
Und last but not least ist die Internetnutzung Teil der ökologischen Nachhaltigkeitsbetrachtung:
- Wieviel Energie verbrauchen Live-Streaming oder Online-Konferenzen?
- Wieviel CO2 entsteht bei Suchanfragen?
Digitale Nachhaltigkeit – soziale Perspektive
Denkt man über digitale Nachhaltigkeit aus der sozialen Perspektive nach, kommt meist zuerst der Begriff „Ethik“ auf. Hier tauchen z.B. Fragen auf wie
- „Ist es ethisch vertretbar, dass Algorithmen stereotype Annahmen enthalten, die zu Diskriminierungen führen können?“ oder
- „Welche und wie viele Komponenten der Hardware wurden durch Kinderarbeit hergestellt?“ oder
- „Wer speichert wo welche Daten über Nutzer:innen und was passiert mit den Daten?“
Bei dieser dritten Frage nähern wir uns dem Zusammenhang zwischen Open Source und Nachhaltigkeit, denn hier kommt der Begriff digitale Souveränität ins Spiel.
Open Source – frei, aber nicht zwingend umsonst
Vorher noch ein paar kurze Anmerkungen zum Begriff Open Source. Meistens wird er synonym für Open Source Software verwendet. D.h. eine Software deren Code offen zugänglich für alle ist und verändert werden darf. Einige Menschen gehen leider davon aus, dass Open Source Software gleichbedeutend mit „kostenlos“ ist, weil es lustige Entwickler:innen gibt, die in der Freizeit nichts Besseres zu tun haben als zu coden und hauptberuflich ihre Brötchen bei irgendeinem IT-Unternehmen verdienen. Es gibt sie, diese Entwickler:innen, die just for fun und kostenlos coden und sich mit Leidenschaft in Open Source Projekten engagieren.
Daneben arbeitet jedoch auch eine Vielzahl von Wirtschaftsunternehmen im Open Source Business Sektor und entwickelt sehr professionell Open Source Software, um kommerzielle Alternativen zu weit verbreiteter proprietärer und/oder monopolistischer Software für Unternehmen und Institutionen anbieten können. D.h. es ist sinnvoll bzw. legitim mit Open Source auch Geld zu verdienen – also im System mit dem System zu arbeiten, um es von innen heraus zu verändern. Beispielhaft sei hier die Open Source Business Alliance, der Bundesverband für digitale Souveränität e.V., erwähnt, der stellvertretend für seine 170 Mitgliedsunternehmen dafür eintritt „Open Source als Standard in der öffentlichen Beschaffung und bei der Forschungs- und Wirtschaftsförderung zu etablieren. Ergänzend existieren verschiedene Verbände und Institutionen, die sich seit langem im Non-Profit-Sektor für den Open Source Gedanken stark machen.
Digitale Souveränität fördert digitale Nachhaltigkeit
Unter digitaler Souveränität versteht man einerseits grundlegende Fertigkeiten, um in einer digitalisierten Welt sicher handeln und die Auswirkungen des eigenen digitalen Verhaltens einordnen zu können. Souveränität geht mit Chancengleichheit/Chancengerechtigkeit einher, für die es des (barriere-)freien Zugangs zu Wissen und entsprechender Infrastruktur bedarf. Andererseits betrifft digitale Souveränität die Hoheit über die eigenen Daten und den Umgang damit. Nur wenn ich die Hoheit über meine eigenen Daten habe, kann ich selbstbestimmt agieren. Wenn meine Daten mir gehören, kann sie niemand missbrauchen, d.h. meine Würde, meine Persönlichkeit und Gesundheit sind geschützt und machen mich weniger verletzlich. Jedoch liegt genau da der Hund begraben: innerhalb unserer digitalisierten Welt befinden wir uns – ganz gleich ob Privatperson oder Unternehmen – aktuell in einer höchst ungesunden Abhängigkeit von wenigen Konzernen, die diese Souveränität verhindern. Eine solch einseitige Abhängigkeit verursacht ein Machtgefälle und kann niemals nachhaltig sein.
Digitale Abhängigkeit vs. Open Source
Seit einigen Jahren wird zum Zusammenhang von Open Source und Nachhaltigkeit geforscht. Im Open Source Jahrbuch 2008, ein Projekt der TU Berlin, das 5 Jahre in Folge (von 2004 bis 2008) publiziert wurde, beschreibt Thorsten Busch den Zusammenhang zwischen Open-Source-Software und dem Begriff Nachhaltigkeit. Die Forschungsstelle Digitale Nachhaltigkeit der Universität Bern integriert ebenfalls Open Source in ihre Arbeit. Dr. Matthias Stürmer, der ehemalige Leiter der Forschungsstelle, formuliert den Zusammenhang so:
„Digitale Nachhaltigkeit will den gesellschaftlichen Nutzen von digitalen Gütern maximieren und definiert sich dadurch, dass digitale Wissensgüter ressourcenschonend hergestellt, frei genutzt, kollaborativ weiterentwickelt und langfristig zugänglich sind. Mit anderen Worten ist Software digital nicht nachhaltig, wenn rechtliche oder technische Abhängigkeiten zu einer Firma oder einer Einzelperson bestehen. Damit werden künftige Generationen in ihrer Handlungsfreiheit eingeschränkt, was der grundlegenden Definition von Nachhaltigkeit widerspricht.“
Open Source Software wird hier als Wert beschrieben, den es langfristig zu erhalten gilt, um Entwicklungsmöglichkeiten (und damit Anpassungen und Verbesserungen an veränderte Rahmenbedingungen) zu schaffen. Open Source Software dient daher global gesehen der Verteilungsgerechtigkeit, die direkt in den SDGS 10 und 16 adressiert wird, indirekt aber auch in den SDGs 1, 4 und 9 steckt. Wenn Menschen des sogenannten globalen Südens freien Zugang zu Quellcodes haben (und gleichzeitig Zugang zum entsprechenden Wissen), sind sie frei sie für ihre Zwecke und Bedürfnisse zu nutzen.
Weitere Bereiche, die sich zwingend von digitalen Abhängigkeiten befreien sollten, um digital nachhaltig zu werden, sind der öffentliche Sektor, d.h. Bund, Länder und Gemeinden sowie das Bildungssystem. Aktuell ist der öffentliche Sektor so gar nicht digital souverän, sondern ist massiv abhängig vom US-Softwareanbieter Microsoft. Dies ist problematisch, denn wenn Bund, noch Länder und Gemeinden digital abhängig sind, können sie ihren Bürger:innen auch keine vollständige digitale Sicherheit bieten. Diese Abhängigkeit wirft auch die Frage nach der Finanzierung auf: Müsste Software, die der öffentliche Sektor nutzt und die steuerfinanziert ist, nicht auch quelloffen sein? Die Initiative Public Money? Public Code! arbeitet daran, freie Software als Standard für öffentlich finanzierte Software zu etablieren. Welche Kosten es verursacht, wenn der öffentliche Sektor digital abhängig ist, beschreibt dieser Blogartikel.
Open Source für alle?
Überträgt man die Problematik des öffentlichen Sektors auf die Wirtschaft, zeigt sich ein ähnliches Abhängigkeitsbild. Microsoft hat weltweit einen Marktanteil von 76,26%³. Dementsprechend sieht es in den Unternehmen aus: das weitverbreitetste Betriebssystem ist Windows, für das operative Geschäft werden die Microsoft-Office-Lösungen verwendet. Eine weitere Abhängigkeit besteht in der SAP-Software, die ebenfalls flächendeckend von Unternehmen genutzt wird. Im Bereich Gestaltung und Grafik dominiert Adobe-Software. Und wer kann sich im beruflichen Kontext ein Leben ohne PDFs (Adobe Acrobat) vorstellen? Alternativen zu MS-Outlook?
Wäre Open Source die Lösung aus der Abhängigkeit? Ein klares Ja. Allerdings muss man dafür sowohl die eigene Komfortzone verlassen (den Umgang mit neuen Programmen lernen) als auch Kosten und Nutzen abwägen. Je stärker die digitale Infrastruktur meines Unternehmens mit proprietären Produkten der Konzerne verstrickt ist, desto mehr Aufwand verursacht ein Komplettausstieg. Auch muss man bei einer Umstellung die bestehenden Schnittstellen zu Drittanbietern, Kunden und Lieferanten berücksichtigen. Es nützt wenig, wenn ich mir eine digital-souveräne Insellösung schaffe, wenn z.B. Lieferanten dann nicht mehr mit mir arbeiten können, weil sie mit nicht-kompatiblen Programmen arbeiten.
Nichtsdestotrotz ist es immer möglich, klein anzufangen und Schritt für Schritt umzustellen, auch wenn am Ende nicht alles Open Source ist. Eine unternehmerisch sinnvolle Strategie ist eine „sowohl-als-auch“-Vorgehensweise, d.h. sich grundsätzlich digital unabhängig zu machen, jedoch die Verbindung zu marktüblicher Software zu halten, um flexibel handlungsfähig zu bleiben.
Nachhaltigkeit ist kein Zustand, sondern ein immerwährender und zyklischer Prozess – ökonomisch, ökologisch und sozial.
Interessieren Sie sich für weitere Erfahrungen aus der Praxis? Testen Sie unseren wöchentlichen Newsletter mit interessanten Beiträgen, Downloads, Empfehlungen und aktuellem Wissen.
[1] World Commission on Environment and Development 1987, S. 54
[2] Quelle: www.bmz.de
[3] Quelle: statista; Stand 2021
Zum Vertiefen:
Digitale Nachhaltigkeit – Kay-Uwe Martens
Forschungstelle Digitale – Open Source Software
Faktenblatt Nachhaltigkeit und Digitalisierung
Wann sind Open Source Projekte digital nachhaltig?
Daniela Röcker hat im t2informatik Blog drei weitere Beiträge veröffentlicht:

Daniela Röcker
Daniela Röcker begleitet als Organisationsentwicklerin und Beraterin mit den Kultur-Komplizen Unternehmen im Kontext Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Ihr Ziel ist es, Bedingungen zu schaffen, damit Mitarbeiter:innen, Führungspersonen und Teams eigenständig Veränderungen umsetzen können. Als Instrument dient ihr u.a. das 2019 selbst entwickelte „Culture Profiling“, dass gemeinsam mit Praxispartnern iterativ weiterentwickelt wird. Die Kultur-Komplizen engagieren sich im Kernteam der #EntrepreneursForFuture Region Stuttgart.
Im t2informatik Blog veröffentlichen wir Beträge für Menschen in Organisationen. Für diese Menschen entwickeln und modernisieren wir Software. Pragmatisch. ✔️ Persönlich. ✔️ Professionell. ✔️ Ein Klick hier und Sie erfahren mehr.