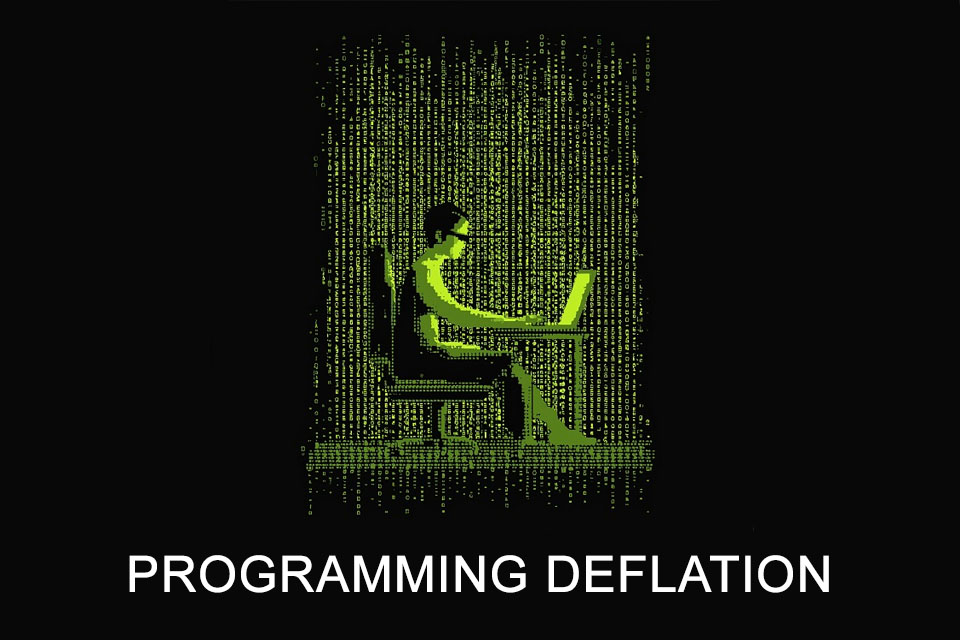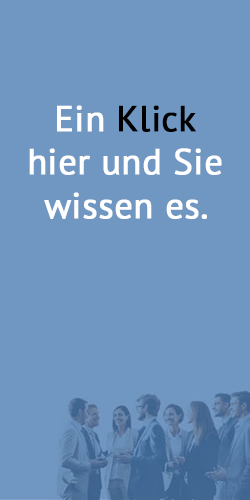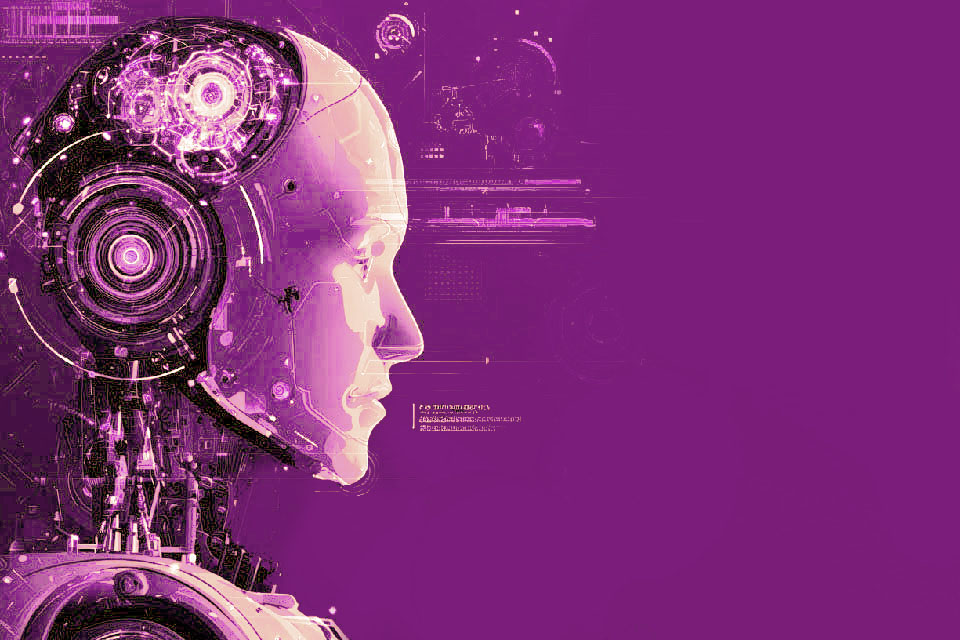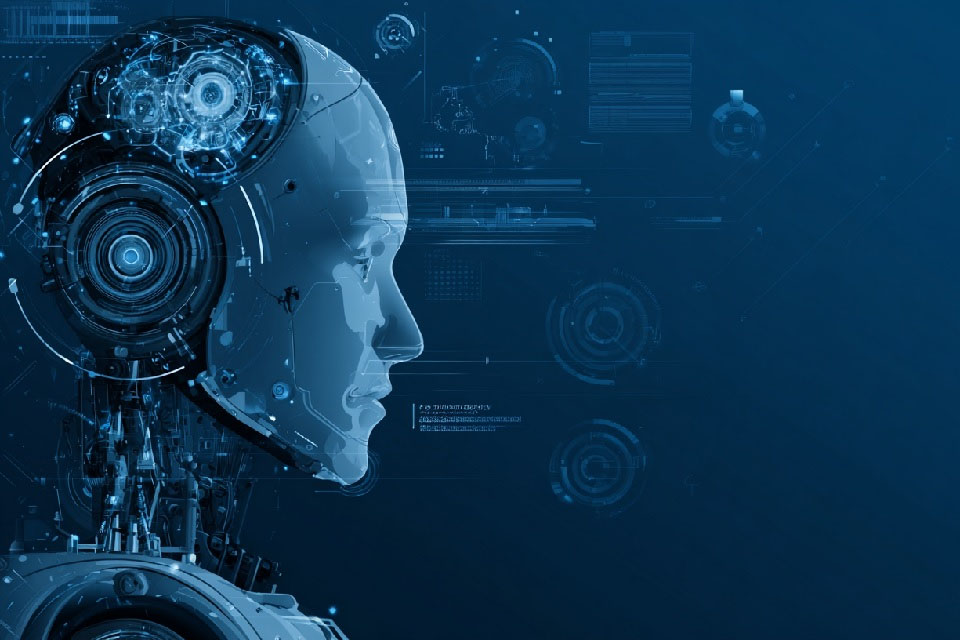Programming Deflation
Wissen kompakt: Programming Deflation beschreibt die Entwertung individueller Programmierkompetenz durch den steigenden Einsatz KI-gestützter Entwicklungstools.
Programming Deflation: Wenn der Wert individueller Programmierung schleichend sinkt
Die zunehmende Verwendung KI-gestützter Tools beeinflusst die Ausübung vieler Berufe und die Wahrnehmung dieser Tätigkeiten. Beobachten lässt sich dies auch in der Softwareentwicklung bzw. bei der Programmierung. Programming Deflation – manchmal auch synonym Coding Deflation [1] oder noch wenig gebräuchlich auf Deutsch Programmierungsdeflation genannt – nennt sich das entsprechende Phänomen. [2]
Um den Begriff der Programming Deflation zu verstehen, lohnt sich ein Blick auf die eigentliche Bedeutung einer Deflation:
Deflation bezeichnet einen anhaltenden Rückgang des allgemeinen Preisniveaus von Waren und Dienstleistungen in einer Volkswirtschaft. Das bedeutet: Geld gewinnt an Wert, man kann sich für den gleichen Betrag mehr leisten als zuvor.
Das klingt zunächst positiv, hat aber meist negative Folgen für die Wirtschaft. Denn wenn Preise dauerhaft sinken, verschieben viele Menschen und Unternehmen ihre Käufe in die Zukunft, in der Hoffnung, dass es später noch billiger wird. Dadurch sinkt die Nachfrage, Unternehmen verkaufen weniger, senken erneut die Preise und entlassen Mitarbeitende; ein Teufelskreis, der Wirtschaftswachstum bremst. [3]
Programming Deflation in der Softwareentwicklung
In der Softwareentwicklung beschreibt Programming Deflation keine ökonomische, sondern eine wertbezogene Veränderung. Mit dem Einzug von KI-Assistenten wie GitHub Copilot, ChatGPT oder Gemini Code Assist hat sich das Programmieren beschleunigt und vereinfacht. Code lässt sich in Sekunden erzeugen, refaktorieren oder testen. Was früher Erfahrung und analytisches Denken erforderte, wirkt plötzlich trivial.
Diese Entwicklung verändert den Wert von Softwarearbeit. KI erzeugt Masse, aber nicht automatisch Verständnis. Sie produziert scheinbar brauchbare Ergebnisse, doch sie vermittelt kein Wissen. Die Programmierarbeit verliert Tiefe, wenn der Mensch nicht mehr versteht, warum eine Lösung funktioniert oder nicht. So wie in der Wirtschaft Deflation zu einer Abwertung realer Güter führt, entsteht in der Softwareentwicklung eine Abwertung menschlicher Kompetenz.
Ursachen der Programming Deflation
Programming Deflation entsteht durch eine Kombination aus technologischen, organisatorischen und kognitiven Faktoren. Einige zentrale Treiber sind:
- KI-Modelle liefern sofortigen Output, ohne dass die Erstellenden das Problem im Detail verstehen müssen. Dadurch verschiebt sich der Fokus von Analyse und Architektur hin zu schneller Ergebnisproduktion.
- Mehr Code in kürzester Zeit erzeugt eine Illusion von Produktivität und Effizienz. Die Qualität des Codes ist jedoch insbesondere in komplexeren Umgebungen oft unangemessen.
- Wer Code übernimmt, statt ihn selbst zu schreiben, vertieft kein Wissen über Prinzipien und Strukturen. Lernprozesse verkürzen sich, das Verständnis für Zusammenhänge sinkt, und Fehler werden später schwieriger zu erkennen.
- KI-Systeme erzeugen vor allem Varianten bekannter Muster. Das führt zu konformem Denken, weniger Experimentierfreude und einem Verlust an kreativer Vielfalt im Code.
- Wenn KI-Vorschläge ungeprüft übernommen werden, sinkt das Bewusstsein für Architekturentscheidungen und langfristige Konsequenzen. Die Verantwortung verschiebt sich vom Menschen zum Werkzeug.
Diese Dynamiken führen dazu, dass Wissen oberflächlicher wird und die Lernkultur in Teams leidet. Das Handwerkliche, Experimentelle und Explorative geht schrittweise verloren.
Auswirkungen auf Organisationen
Programming Deflation verändert nicht nur individuelles Lernen, sondern auch die Struktur von Teams und Unternehmen. [4]
Wenn KI-Systeme Aufgaben automatisieren, scheint Softwareentwicklung günstiger und schneller zu werden. In Wahrheit verschiebt sich der Aufwand: Statt zu konzipieren und zu verstehen, müssen Teams mehr prüfen, korrigieren und nacharbeiten. Fehlende Architekturentscheidungen oder unklare Verantwortlichkeiten führen zu technischen Schulden, die erst später sichtbar werden.
In vielen Organisationen entsteht zudem eine Wahrnehmungsdeflation: Der Beitrag erfahrener Entwicklerinnen und Entwickler wird unterschätzt, weil KI scheinbar alles kann. Das führt möglicherweise zu falschen Investitionsentscheidungen, geringerer Ausbildungsbereitschaft und einer Erosion der Kompetenzbasis. Langfristig gefährdet das die Innovationsfähigkeit eines Unternehmens, insbesondere dann, wenn kritisches Denken, Codeverständnis und Reflexion verloren gehen.
Wege aus der Programming Deflation
Programming Deflation ist kein Schicksal, sondern das Ergebnis einer fehlenden Balance zwischen Automatisierung und menschlichem Können. Organisationen können diesem Trend aktiv entgegenwirken, wenn sie den bewussten und reflektierten Umgang mit KI fördern. Wichtige Hebel dafür sind:
- KI soll unterstützen, nicht ersetzen. Sie darf den Menschen nicht aus der Verantwortung entlassen. Aufgaben müssen nachvollziehbar, überprüfbar und erklärbar bleiben, damit Entscheidungen transparent und fachlich fundiert getroffen werden können.
- Wer reflektiert, lernt. Regelmäßige Code Reviews, Pair Programming und Retrospektiven helfen, Verständnis zu vertiefen und Wissen zu teilen. Eine gelebte Lernkultur sorgt dafür, dass Teams nicht nur schneller, sondern auch klüger arbeiten.
- Gute Software entsteht nicht durch Code allein, sondern durch bewusst gestaltete Strukturen. Wer Architekturentscheidungen nachvollzieht und dokumentiert, schafft ein stabiles Fundament für nachhaltige Entwicklung, unabhängig davon, ob der Code von Menschen oder Maschinen stammt.
- Nachhaltige Software misst sich nicht an der Anzahl produzierter Zeilen, sondern an Wartbarkeit, Stabilität und Lesbarkeit. Qualitätssicherung, Tests und langfristige Pflege sollten höher bewertet werden als kurzfristiger Output.
Nur wenn Organisationen in Kompetenzentwicklung, kritisches Denken und technische Exzellenz investieren, kann KI zu einem Werkzeug werden, das stärkt, statt zu entwerten.
Impuls zum Diskutieren
In zehn Jahren wird kaum noch jemand wissen, wie Software wirklich funktioniert und das wird uns teuer zu stehen kommen.
Hinweise:
Wenn Ihnen der Beitrag gefällt, teilen Sie ihn gerne in Ihrem Netzwerk. Und falls Sie sich für Tipps aus der Praxis interessieren, dann testen Sie unseren wöchentlichen Newsletter mit neuen Beiträgen, Downloads, Empfehlungen und aktuellem Wissen. Vielleicht wird er auch Ihr Lieblings-Newsletter.
[1] Die beiden Begriffe Programming Deflation und Coding Deflation setzen unterschiedliche Akzente: Programming Deflation wirkt konzeptioneller, umfasst auch Architektur, Problemlösung und Denkprozesse, also die gesamte Programmierarbeit, nicht nur das Tippen von Code. Coding Deflation klingt hingegen etwas griffiger und alltagstauglicher, beschreibt aber stärker den sichtbaren Teil der Arbeit: das Schreiben von Code und die Automatisierung durch KI.
[2] Etwas allgemeiner wird auch von Knowledge Deflation gesprochen.
[3] Deflation unterscheidet sich auch von einer sogenannten Desinflation, bei der die Preise zwar weiter steigen, aber langsamer als zuvor. Bei Deflation dagegen fallen die Preise tatsächlich.
[4] Kent Beck, einer der Unterzeichner des Agilen Manifests, sieht zwei Auswirkungen auf die Branche zukommen: Entweder es gibt einen Substitutionseffekt, da weniger Programmierer benötigen werden und Maschinen menschliche Arbeitskraft ersetzen. Oder die Nachfrage steigt, wenn etwas billiger wird, da das billigere Gut in einer größeren Bandbreite von Fällen wirtschaftlich rentabel ist (das sogenannte Jevons-Paradoxon).
Hier finden Sie ergänzende Informationen aus unserem t2informatik Blog: